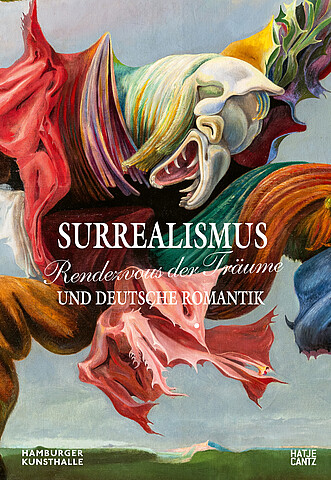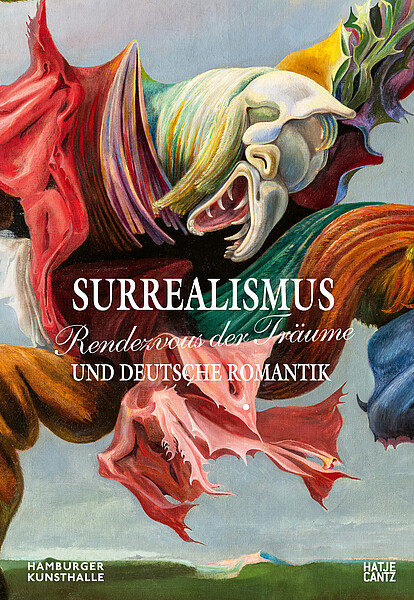Ein Rendezvous zum Vergleichen
„So schön wie die zufällige Begegnung einer Nähmaschine und eines Regenschirms auf einem Seziertisch“: Diese berühmte Sentenz von Comte de Lautréamont, die auf die ästhetischen Praktiken des Surrealismus einwirkte, mag Besucherinnen und Besuchern in den Sinn kommen, wenn sie die Ausstellung Rendezvous der Träume. Surrealismus und deutsche Romantik in der Hamburger Kunsthalle betreten. Auf den ersten Blick scheinen die oftmals farbgewaltigen, phantasievollen Werke des Surrealismus stilistisch wenig mit den Bildwerken der deutschen Romantik gemein zu haben. Doch die Hamburger Ausstellung lädt dazu ein, den Ähnlichkeiten und impliziten wie expliziten Bezugnahmen nachzugehen – und zwar durch intensives vergleichendes Sehen in einem kuratorisch fein justierten Parcours der Konstellationen.
Der Verweis auf die produktive Bezugnahme des Surrealismus auf die (deutsche) Romantik ist nicht neu: Unter anderem haben Alfred Barr, Walter Benjamin oder Karl Heinz Bohrer die Beziehung – in jeweils unterschiedlicher Nuancierung – thematisiert, darauf verweist gleich zu Beginn der Ausstellung ein Zeitstrahl. Die Hamburger Schau nimmt das hundertjährige Jubiläum von André Bretons Manifest des Surrealismus (1924) zum Anlass, um nach der „Geistesverwandtschaft“ – wie es in den Begleittexten heißt – zwischen dem Surrealismus und der deutschen Romantik zu fragen, die von den Vertreterinnen und Vertretern des Surrealismus selbst immer wieder hervorgehoben wurde. Die Schau entstand in Kooperation mit dem Centre Georges Pompidou in Paris und war dort wie auch an anderen Stationen in veränderter Form zu sehen. In Hamburg sind ca. 300 Werke ausgestellt: Surrealistische Positionen von Salvador Dalí, Max Ernst, Dorothea Tanning und Meret Oppenheim stehen solchen der deutschen Romantik, vertreten z. B. durch Bettina von Arnim, Caspar David Friedrich und Philipp Otto Runge, gegenüber. Damit markieren zwei Sammlungsschwerpunkte des Hauses das Zentrum der Ausstellung, die durch die geschickten Konstellationsbildungen der Kuratorin Annabelle Görgen-Lammers und ihren Assistenzkuratorinnen Vera Bornkessel und Maria Sitte den Betrachterinnen und Betrachtern eine neue Sichtweise auf beide künstlerischen Bewegungen eröffnet.
Die Ausstellung ist in drei räumlich getrennte Sektionen aufgeteilt, die mit den Titeln „Traum“, „Wald“ und „Kosmos“ eine thematische Ordnung vorgeben, die sich noch weiter in kleinere thematische Abschnitte zu Themen wie z. B. „Freundschaft“, „Liebe“, „Ruinen“ verzweigt. In einem ergänzenden Bereich „Passage“, der den Übergang zwischen den Ausstellungsteilen bildet, stehen interaktive Stationen zum Eingreifen und Mitmachen bereit. Die gewählten Titel der Ausstellungsbereiche rufen bekannte Kernthemen der deutschen Romantik auf. Und doch stehen die Werke des Surrealismus im Zentrum dieser Ausstellung.
In der ersten Sektion zum Thema „Traum“ leuchtet innerhalb der blauen, dunklen Ausstellungsarchitektur Max Ernsts farbenfrohes Gemälde Der Hausengel (Der Triumph des Surrealismus) (1937) aus der Mitte des Raumes hervor. Die Darstellung des Ungeheuers auf diesem Bild wurde häufig als Verweis auf die Bedrohung durch den Faschismus verstanden, dem sich auch die Surrealistinnen und Surrealisten zu stellen hatten. Die Werke der deutschen Romantik ordnen sich unter, indem sie sich über den gesamten Ausstellungsraum verteilen. So findet sich Caspar David Friedrichs Wanderer über dem Nebelmeer (um 1817) nach einem Jahr der publikumswirksamen monographischen Ausstellungen zu diesem Künstler nun nicht mehr im räumlichen Zentrum der Thematik. Doch die Werke der deutschen Romantik laden zum vergleichenden Sehen ein: So wird Friedrichs Wanderer neben Max Ernsts Weib, Greis und Blume (1923) präsentiert. Die Gegenüberstellung lässt motivische Analogien erkennen wie z. B. die Rückenfigur vor einer weiten Landschaft, aber auch deutliche Unterschiede mit Blick auf die Figurenanzahl und nicht zuletzt die Malweise.
So geht es weiter: Das Nebeneinander von Johan Christian Clausen Dahls Fensterbild Blick auf Schloß Pillnitz (1823) und Marcel Jeans Surrealistischer Schrank (1941) verweist über die durch den Vergleich hervorgehobene motivische Ähnlichkeit auf das Interesse beider Bewegungen für das Verhältnis von innerem und äußerem Erleben, Subjekt und Welt. Gleichzeitig wird gerade an diesem Beispiel deutlich, dass der Surrealismus sich anderer künstlerischer Mittel und Medien bedient als die oftmals an Leinwand und Papier gebundene Romantik: Jean malte sein illusionistisches Bild der Schranktüren direkt auf eine überdimensional große Schranktür und verdoppelt qua Bildträger somit nochmals das Spiel mit Illusion und Wirklichkeit. Und so fädeln sich die Vergleichsangebote durch die Ausstellung, die hauptsächlich auf motivischen Ähnlichkeiten aufbauen: Max Ernsts großes (und ehemals in Hamburger Privatbesitz befindliches) Gemälde Das Rendezvous der Freunde (1922) wird neben Johann Heinrich Tischbeins sehr viel kleinerem Freundschaftsbild Einer den anderen gemalt (1782) gezeigt. Darüber hinaus werden auch viele Hommagen präsentiert, die sich in den Titeln direkt auf die Romantikerinnen beziehen, so z. B. in Meret Oppenheims Für Bettine Brentano und Für Karoline von Günderrode (beide 1983).
Das gelungene Ausstellungsdesign wirkt dabei dem allzu einfachen Vergleichen entgegen: Auf der leporellohaften, dunkelblauen Ausstellungsarchitektur werden die Werke zumeist nicht auf planer Fläche nebeneinander gezeigt, sondern stehen immer schon in leicht versetztem Winkel zueinander. Auf diese Weise bleibt der vergleichende Blick auf die manchmal etwas ‚einfachen‘ motivischen Ähnlichkeitsbehauptungen zwischen den Werken der beiden künstlerischen Bewegungen nicht ungebrochen. Die Unterschiede in den (impliziten wie expliziten) Rezeptions- und Aneignungsprozessen werden dabei jedoch weder eigens hervorgehoben, noch eine Differenzierung der vielfältigen Kriterien der Bezugnahmen (motivisch, formal usw.) vorgenommen. So bleibt auch offen, ob einige Parallelen und Analogien allein durch unseren nachträglichen Blick – gefördert durch die kuratierten Vergleichsangebote – gezogen werden oder als solche bereits durch die Künstlerinnen und Künstler beabsichtigt sind.
Dies wird jedoch durch die Lektüre der ausgestellten textuellen Dokumente deutlicher: Die Werke der bildenden Kunst werden in allen Ausstellungsbereichen um Vitrinen mit Dokumenten und Publikationen ergänzt, die sowohl die literarische, programmatische und kontextuelle Einbettung beider Strömungen bezeugen. Dies wird am eindrücklichsten dort, wo Bretons Manifest des Surrealismus (1924) auf Manuskripte von Novalis mit Zeilen wie „[…] die Welt muß romantisirt werden […]“ (undatiert) trifft. Breton hat sich in einer Fußnote seines Manifests direkt auf Novalis bezogen. Anhand der Schriftstücke wird deshalb hervorgehoben, was anhand der Vergleichskonstellationen im Ausstellungsraum in den Hintergrund tritt: Die Selbstdefinition, die sich die surrealistische Bewegung vor allem in ihren programmatischen Schriften mit der Bezugnahme auf die deutsche Romantik aufbaute. Indem Breton sich in den Manifesten und weiteren Schriften direkt auf die Romantik berief, arbeitete er am Image des Surrealismus, im Katalog häufig als „historische Selbstdefinition“ beschrieben. [1] Dabei bedienten er und andere Surrealistinnen und Surrealisten sich allerdings nur einiger Aspekte der Romantik (die sich in den Titelsetzungen der Ausstellungsabschnitte widerspiegeln), andere Kernelemente der Bewegung – ihr Bezug zur Religion oder zum Nationalismus – wurden hingegen ignoriert oder umgedeutet.
Ein Manko der Ausstellung mag darin liegen, dass die Differenzen zwischen den beiden künstlerischen Bewegungen nicht eigens thematisiert werden. Und diese sind doch vielfältig sowohl mit Blick auf die gesellschaftlich-politische Situation, in denen beide Bewegungen entstanden und zu denen sie sich verhalten mussten, als auch bezüglich ihrer genuin künstlerischen Produktionsweise und Formgebung. Die mediale Vielfalt des Surrealismus wird in der Ausstellung zwar durch Plastiken, Film und Fotografie deutlich vor Augen gestellt, die gesellschaftskritische Bedeutung dieser Wahl der neuen – auch technischen – Medien bleibt aber unbenannt. Zwar wird in der Ausstellung wie auch im Katalog (z. B. im Beitrag von Markus Bertsch) auf die Ähnlichkeit der künstlerischen Verfahren in Hinblick auf die Betonung des Prozesshaften und die Einbindung des Zufalls hingewiesen – Klecksografie oder die Kratz- und Abriebtechniken der Surrealisten –, die Unterschiede werden dabei jedoch kaum betont.
Auch die Ungleichheit in der Begrenzung (oder Begrenzbarkeit?) der beiden künstlerischen Bewegungen ist auffällig: Während die deutsche Romantik mit Werken der ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts in der Ausstellung vertreten ist, wird die internationale Gruppierung der Surrealistinnen und Surrealisten mit Werken von den 1920er Jahre bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts in breiter zeitlicher Streuung präsentiert. Es bleibt unklar, aufgrund welcher Kriterien (programmatische Selbstzuordnung, Stilistik oder Rezeption) die Zugehörigkeit zum Surrealismus jeweils erfolgt.
Die Ausstellung steht mit dem Verweis der Bezugnahme und Weiterführung des romantischen Gedankenguts als künstlerische Ausdrucksform in der Tradition bekannter Expositions- und Buchprojekte der vergangenen Jahrzehnte: Im Katalog wird z. B. verwiesen auf Robert Rosenblums Publikation Modern Painting and the Northern Romantik Tradition: Friedrich to Rothko (1975) oder die Ausstellungen Ernste Spiele (1995, Haus der Kunst, München), Trajectoires du rêve. Du romantisme au surréalisme (2003, Pavillon des Arts Paris) und Schwarze Romantik. Von Goya bis Max Ernst (2012, Städel Museum, Frankfurt am Main). Anders als in den meisten dieser Projekte ist der Ausstellung jedoch kein historiographisches Anliegen abzulesen: Weder hebt sie kuratorisch darauf ab, die Entwicklung des Romantik-Bezugs innerhalb des Surrealismus selbst stärker auszuwerten und zu historisieren (der Schwerpunkt der Bezüge ist für die 1930er und 1940er Jahre festzustellen), noch macht sie eine stilistische Entwicklungsgeschichte ablesbar, wie es Rosenblum in seiner Publikation mittels Gegenüberstellungen von Werken Caspar David Friedrichs und Mark Rothkos für die moderne Malerei vorgeführt hat. [2] Auch die Bestimmung der historischen Rolle, die die Romantik für den Surrealismus einnimmt, bleibt in der Ausstellung offen, im Katalog sind hingegen unterschiedliche Formulierungen zu finden: mal „kündigten sich zentrale Aspekte des Surrealismus schon in Novalis’ […] Konzept des sogenannten ‚magischen Idealismus’ an“, mal ist von einer mehr oder weniger bewussten „Hinwendung“ der Surrealistinnen und Surrealisten zur Romantik die Rede. [3] Es bleibt also unentschieden, ob die Romantik als Vorläufer oder als Bezugspunkt verstanden wird (wenn auch die letztere Lesart in der Ausstellung stärker vor Augen tritt).
Die Kuratorin Görgen-Lammers hebt in ihrem einführenden Aufsatz im Katalog hervor, dass die Ausstellung zeigen möchte, wie „in surrealistischer Poesie, Kunst und Theorie eine Neubewertung der deutschen Romantik“ [4] erkennbar wird. Hiermit tritt ein Anspruch zu Tage, der in den Ausstellungsräumen kaum deutlich, im Katalog hingegen mehrfach hervorgehoben wird: Es geht darum, dass andere „Erbe“ der Romantik aufzuzeigen, im Kontrast zur Rezeption und Vereinnahmung, die diese Bewegung durch die Nationalsozialisten – interessanterweise nahezu zeitgleich – erfahren hat. Anschließend an eine von Michael Löwy und Robert Sayre [5] dargelegte Systematik der unterschiedlichen Bezugnahmen auf die Romantik argumentiert Will Atkin in seinem Katalogbeitrag, dass der Rückbezug auf die Romantik für den Surrealismus als Zeichen des Widerstands gelesen werden könnte. [6]
Der fundierte Katalog ist damit nicht nur als Parallellektüre zum Besuch der Ausstellung zu empfehlen. Durch seine eigene Ordnung – nach Künstlerinnen und Künstlern sowie Themen –, vor allem aber durch seine bildlichen Gegenüberstellungen und Vergleichsangebote bietet er eine eigene Sichtweise der Ausstellung. So erläutert er ergänzend auch fundiert die Hintergründe zu einer Vergleichskonstellation, die den lokalen Bezug zur Stadt Hamburg herstellt. [7] In der Ausstellung hängt Max Ernsts Ein schöner Morgen (1965) in nächster Nähe zu Philipp Otto Runges Der Morgen (erste Fassung) (1808). Ernst schuf das Werk ein Jahr nach seinem Besuch in Hamburg, wo er auch Runges Bildfindung lange studiert hatte. Und ja: Nicht nur die Titelgebung, sondern auch formale Bezüge sind zu erkennen. Das vergleichende Sehen, das durch die Ausstellung motiviert wird, ermöglicht im romantischen wie auch im surrealistischen Sinne ein Mehr-Sehen und ein Anders-Sehen.
Es bleibt jedoch der Eindruck, als rückten die Unterschiede zwischen beiden Gruppierungen und ihren historischen Kontexten in den Hintergrund zugunsten der Betonung der Ähnlichkeiten, die durch die kuratierten Vergleichsangebote der Ausstellung so stark in den Vordergrund gestellt werden. Vergleiche sind suggestiv, prozesshaft und zeigen etwas unter dem Eindruck von etwas anderem. Unter anderen Umständen würden wir es so nicht sehen. Das macht das Vergleichen als eine Praktik der Kombinatorik vielleicht auch gerade zu einem Verfahren, das den (romantischen) Witz der Ausstellung selbst unterstreicht.
Anmerkungen
[1] Annabelle Görgen-Lammers: Ein Fest der Analogien. Beobachtungen zum Rendezvous von Surrealismus und deutscher Romantik, in: Annabelle Görgen-Lammers (Hg.): Rendezvous der Träume. Surrealismus und deutsche Romantik, Ausst.-Kat. Hamburger Kunsthalle, Berlin 2025, S. 16–35, hier S. 24.
[2] Robert Rosenblum: Modern Painting and the Northern Romantic Tradition, London 1975.
[3] Görgen-Lammers: Fest der Analogien, S. 24.
[4] Ebd.
[5] Michael Löwy/Robert Sayre: Romanticism Against the Tide of Modernity, Durham 2001.
[6] Will Atkin: Die Romantik des Surrealismus. Über Träume, Widerstand und die poetische Fülle des Lebens, in: Annabelle Görgen-Lammers (Hg.): Rendezvous der Träume. Surrealismus und deutsche Romantik, Ausst.-Kat. Hamburger Kunsthalle, Berlin 2025, S. 37–48.
[7] Vgl. Görgen-Lammers: Fest der Analogien.
Dieser Text ist unter dem nachfolgenden Link dauerhaft abrufbar:
https://doi.org/10.22032/dbt.68202