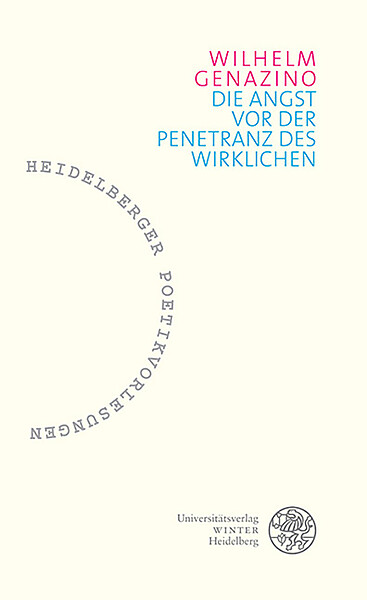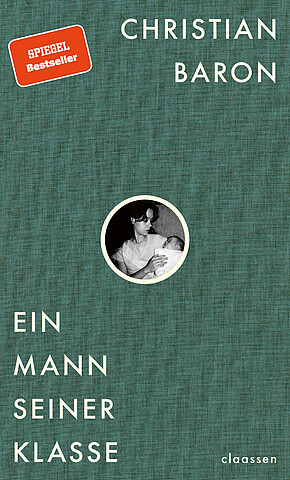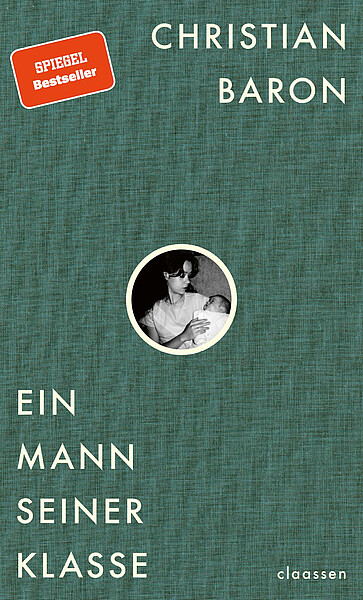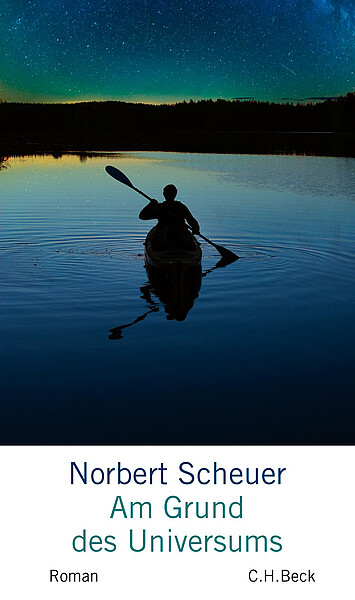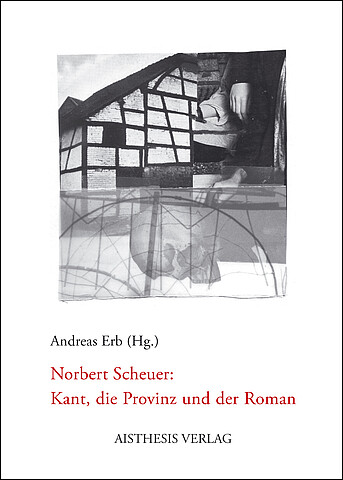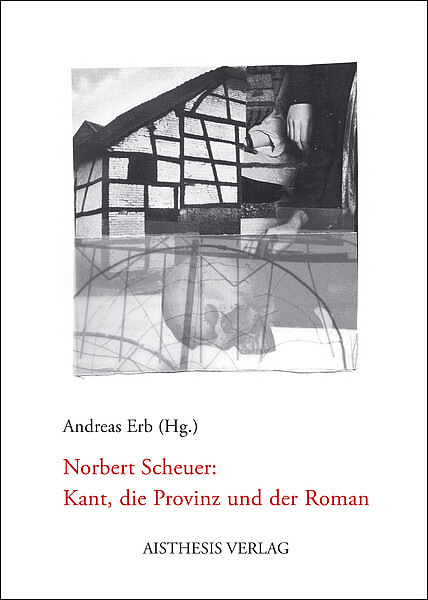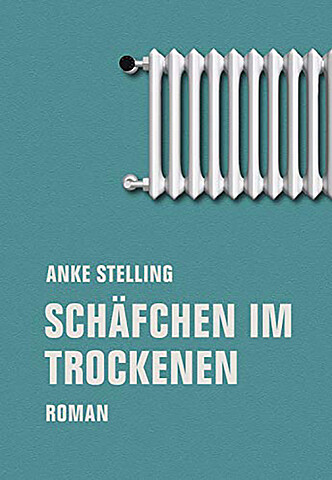Kein Entkommen?
Julia Schreiter: Im Dezember 2020 sind Wilhelm Genazinos Heidelberger Poetikvorlesungen erschienen, in denen er sich mit der „Penetranz des Wirklichen“ beschäftigt. Dieses Phänomen besagt, dass einem die Gesellschaft zu nahe kommt, dass sie keinen Platz für das Individuum lässt. Der Alltag, die anderen Menschen, die gesellschaftlichen Anforderungen, die Kaufappelle und billigen Massenunterhaltungen sind allgegenwärtig. Dagegen können sich die Figuren abschirmen, indem sie sich eine eigene Welt kreieren und Strategien des Verbergens entwickeln. Einen Abstand zur aufdringlichen Realität können sie mithilfe einer Poetik des genauen Blicks schaffen – einer Romantisierung der Welt. Der Protagonist im Roman Ein Regenschirm für diesen Tag leidet an seiner gesellschaftlichen Randstellung. Er geht umher und macht Beobachtungen, die nur ihm gehören, weil kein anderer auf diese Dinge achtet.
Martin Hielscher: Ich sehe Genazino in der Tradition der Städte-Romanciers. Er kommt in seinen Poetikvorlesungen selbst auf Virginia Woolfs Mrs. Dalloway und James Joyce‘ Ulysses zu sprechen. Und es fängt ja bei Baudelaire und Poe an, wenn jemand einfach durch die Stadt läuft und die Großstadt als unstrukturierte Gemengelage in den Blick kommt. Das ist dezidiert eine moderne Stadterfahrung.
J. S.: Beobachten Sie diese Tendenzen – umhergehen und beobachten – bei anderen zeitgenössischen Autoren? Inwieweit kann ein poetischer Blick bei der Bewältigung von Problemen helfen?
M. H.: Die Stadt gewinnt ja als Wohnraum weiter an Bedeutung, daher nehmen auch die literarischen Auseinandersetzungen in dieser Form zu. Genazino hat beim Schreiben ein historisches Bewusstsein des Moments seines Schreibens, das über einen rein ästhetischen Zugriff hinausgeht. Es geht ihm auch darum, was das Streunen soziologisch und konsumhistorisch bedeutet. Da zeigt sich eine Strategie, die man momentan sowohl in der deutschsprachigen Literatur als auch international findet. Mit New York hat sich der nigerianisch-amerikanische Schriftsteller Teju Cole in Open City befasst. Hier findet man das gleiche Prinzip: Der Protagonist geht durch die Stadt und denkt über die Welt und die Veränderung der Verhältnisse nach. Hier kommen noch die Themen Rassismus und multikulturelle Identität hinzu.
In den deutschen Romanen von Martin Mosebach laufen die Protagonisten durch Frankfurt und haben amouröse Abenteuer. Auch Peter Kurzeck schreibt durchweg autofiktionale Texte, in denen durch Frankfurt flaniert wird. Er beschreibt aber eher ein prekäres Milieu. Bei Genazino geht es ja ums Kulturprekariat und einen Abstieg. Der Protagonist ist sehr gebildet, aber ihm fehlt die entsprechende soziale Stellung. Er wird von seiner Freundin verlassen, weil er beruflich nicht hinterher ist, weil er sich nicht kümmert. Frauen geben ihm immer wieder Halt. Mit seinem Streunertum hängt eine promiskuitive Sexualität zusammen.
J. S.: Das ist ein Bereich, in dem sich die Ambivalenz von Konsum und dessen Abwehr zeigt. Denn paradoxerweise wendet er sich zwar permanent gegen Konsum und Vergnügungen, aber bezahlt seine Friseurin Margot für Sex. Einer Bekannten gegenüber verkauft er sich als Vermittler authentischer Erlebnisse, bringt sie aber am Ende ausgerechnet ins Fernsehen, wo sie sich als Teil der Massenmedien wichtig fühlt.
M. H.: Der Protagonist widerspricht sich permanent. Es gibt kein Entkommen aus der totalitären Stadterfahrung. Diese Art Literatur betreibt keine Kapitalismuskritik mehr, sondern zeigt die komplette Unentrinnbarkeit der Stadt. Daher kommt Genazino in seinen Vorlesungen auf die Kritische Theorie und Adorno zu sprechen. Aber anders als Adorno zeichnet er die Gegenwart nicht schwarz, sondern ironisiert sie und führt sein poetisches Gegenprogramm vor.
Dabei entsteht aber keine Ideologie, weil Genazino immer auch das Falsche an den Strategien zeigt. Er beschreibt am Ende vom Regenschirm z. B. dieses oberflächliche Stadtfest. Das ist nicht eskapistisch. Und er räumt die Blätter wieder aus dem „Blätterzimmer“, zu dem er das alte Zimmer seiner Ex-Freundin gemacht hat.
J. S.: Wobei das Blätterzimmer auch für die Gefahr steht, verrückt zu werden und völlig abgeschoben zu werden. Der Protagonist muss die Zumutungen der Welt immer in etwas anderes übersetzen und ist permanent davon bedroht, abgeschoben zu werden, wenn die anderen sein Programm durchschauen. Zugleich läge im Wahnsinn eine Entlastung: Keiner würde mehr etwas von ihm wollen.
M.H.: Aber er hat auch eine vitale Gegenkraft: sein sexuelles Begehren. Er ist attraktiv, produziert Kunst und verdient Geld. Er erweist sich als erstaunlich widerstandsfähig, geistesgegenwärtig und witzig. Das Schlussbild des Romans ist positiv: Genazino zeigt, wie sich ein kleiner Junge eine Höhle auf dem Balkon baut und das Stadtfest beobachten kann, ohne selbst gesehen zu werden. Damit delegiert er die poetische Gegenkraft an die nächste Generation. Die Menschheit wird nicht damit aufhören, sich die Welt schöner zu machen.
J.S.: Dabei bleibt die Frage offen, wie stark das poetische Gegenprogramm gelingt. Denn es gibt zwar dieses positive Gegenbild, aus dem der Protagonist Zuversicht gewinnt. Aber das Bild wird wie die anderen Trostspender nur vorübergehend Linderung bringen. Wie es mit dem Protagonisten weitergeht, ist unklar. Er hat eine neue feste Anstellung und eine neue Freundin, aber beide passen nicht zu ihm. Die Ambivalenz bleibt ein weiteres Mal.
M.H.: Auch das lässt wieder an Adorno denken: Es gibt keine erkennbare gesellschaftliche Lösung. Das Einzige, was man tun kann, ist die Gegenwart in die Schwebe zu bringen und einen Schimmer zu zeigen, was anders sein könnte. Kunst darf nur für den Moment auftauchen und muss permanent gebrochen werden, sie darf nicht verfügbar sein, sondern muss eine Provokation bleiben.
J.S.: Diese Schwebe verkörpern Genazinos Romane als Kunstprodukte. Sie deuten an, wie es gehen könnte, das Gelingen aber bleibt fraglich. Diesen Gedanken findet man ja schon in der Romantik: Kunst und Leben spiegeln sich wechselseitig, aber gehen nicht ineinander auf.
Wie Kunstwerke unverfügbar sein können, zeigt Genazino in Der Fleck, die Jacke, die Zimmer, der Schmerz. Die beiden Protagonisten – ein Künstlerpaar – suchen eine ganz individuelle Form der Kunst, die kein anderer versteht. Der Anblick des Arbeitstisches wird zum Kunstwerk, aber es darf kein Foto davon geben, da es sonst ein Bild für andere wäre. Anders, affirmativer, gestaltet Christian Baron in seinem autobiografischen Roman Ein Mann seiner Klasse das Thema Massenmedien. Als Junge entflieht der Protagonist gerade in die Massenunterhaltung: ins Fernsehen und in Videospiele. Also auch in eine Gegenwelt, aber gerade nicht durch einen poetischen Blick.
M.H.: Baron kommt daher, wohin Genazino Angst hat, abzurutschen. Die Mutter ist die tragischste Figur, da sie als begabte Schülerin die Anlagen hatte, zu entkommen, es aber nicht schaffte. Sie verfasste Gedichte – Literatur als Entkommensstrategie ist in der Familie also angelegt. Dagegen läuft aber ein proletarisches Selbstzerstörungsprogramm. Entkommene werden als Verräter an der Klasse gesehen.
J.S.: Beide Protagonisten nähern sich ähnlich ihrer Kindheit. Sie suchen Orte auf, die sie zu Assoziationen über ihre Kindheit anregen.
M.H.: Und auch Genazinos Milieu ist gar nicht so weit von Barons entfernt: die relative Armut. Aber Baron schildert seine Kindheit viel schonungsloser – es geht ausdrücklich um das Arbeitermilieu. Auf der Erzählebene geht es auch ums Entkommen, aber nicht als poetische Verwandlungsstrategie.
J.S.: Barons Protagonist entkommt am Ende durch Bildung. Er wird von seiner Mutter gesehen und nimmt das Programm an. Für Genazino greift Bildung nicht mehr, da sie ihm nicht die entsprechende gesellschaftliche Stellung einbringt.
M.H.: Es gibt also ganz unterschiedliche Antworten auf die Frage: Wie schreibe ich über Armut und die Angst abzurutschen? Poetisiere ich? Oder finde ich für die Krassheit eine Sprache? Auch um den abgefederten Kulturbetrieb zu durchbrechen, in dem Leute nichts mit Not zu tun haben oder nicht darüber sprechen. Einen dritten Weg findet Anke Stelling. Sie steht zwischen Baron und Genazino. In Bodentiefe Fenster und Schäfchen im Trockenen schildert sie auch die Abstiegsangst in einer recht gut versorgten Alternativszene in Berlin am Prenzlauer Berg. Wenn die Protagonistin, eine Frau mit Mann und Kindern, feststellen muss, dass sie, als sie und ihre Familie aus der Mietwohnung ausziehen müssen, nicht über dieselben Mittel verfügt wie ihre intellektuellen und etablierten Freunde, zu denen sie sich immer zugehörig gefühlt hat und zu denen sie, mit einem Fuß im Prekariat, doch nicht gehört hat. Aber es ist auch eine analytische Schärfe in ihren Büchern und eine trotzige Wut. Barons Protagonist hat nichts zu verlieren, er kann nur gewinnen, wenn er aus dem Sog der Selbstzerstörung heil herauskommt und seine Möglichkeiten nutzt und es erträgt, aus seiner Klasse aufzusteigen. Genazinos Protagonist nutzt den poetischen Gegenzauber und die Genialität der Kunst, solange dies auch existenziell möglich ist, ist aber seelisch auf jeden Verlust vorbereitet. Anke Stellings Protagonistin kann nicht ganz mithalten, darf aber auch nicht aufgeben oder verlieren. Sie hat eine Familie, Kinder, die auf sie bauen, eine Verantwortung, die sie im Diesseits, im Leben und in der Kunst, hält.
J.S.: Herr Hielscher, unser Gespräch begann bei Wilhelm Genazinos Heidelberger Poetikvorlesungen, aus denen ich gern einen problematisch gewordenen Begriff herausgreifen und auf seine heutigen Möglichkeiten hin befragen möchte – die Heimat. Als Programmleiter Belletristik beim Verlag C. H. Beck betreuen Sie Norbert Scheuer, der sich dezidiert mit Heimat auseinandersetzt. Wie kann man heute noch über Heimat schreiben?
M.H.: Man kann sich sicherlich nur noch gebrochen mit dem Begriff beschäftigen. Er ist zu einer utopischen Kategorie geworden – als affirmative Kategorie wurde Heimat ideologisch kontaminiert. Diesen utopischen Horizont hat Ernst Bloch im Prinzip Hoffnung in einer sehr schönen Passage so beschrieben: „Die Wurzel der Geschichte ist aber der arbeitende, schaffende, die Gegebenheiten umbildende und überholende Mensch. Hat er sich erfaßt und das Seine ohne Entäußerung und Entfremdung in realer Demokratie begründet, so entsteht in der Welt etwas, das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war: Heimat.“ Das könnte in dieser dialektischen Wendung des Schlusssatzes auch von Theodor Adorno stammen, der diese Verklammerung von Glücksahnung aus der Kindheit und utopischem Horizont in einer befreiten Gesellschaft auch immer so gedacht hat, Heimat als etwas, das wir eigentlich in gewisser Weise kennen, worin aber noch nie jemand war, ganz gewiss nicht die, die mit den Füßen stampfend darauf beharren.
J.S.: Die Romantiker verwenden Heimat noch affirmativ. Sie ist eine Mischung aus realem Raum und Sehnsuchtsort – das Unerreichbare. Im Taugenichts kommt sie z. B. nur als etwas zeitlich und lokal Entferntes vor, an das man mit Nostalgie zurückdenkt. Oder sie liegt als himmlische Heimat gänzlich utopisch im Jenseits. Das Gefühl der Sehnsucht hängt stark mit Heimat zusammen.
M.H.: Heute schwingt bei Nostalgie eine Kitschgefahr mit, wenn affirmativ über Heimat gesprochen wird. Denn der Kapitalismus macht alles sofort zum Konsumgut und zerstört es, aber an der Sehnsucht ist nichts Falsches.
J.S.: Wie findet sich Heimat in Scheuers Romanen?
M.H.: Bei ihm geht es um die Eifel – eine wirtschaftlich abgehängte Region. Die Gegend war durch den Bergbau reich geworden, aber heute sind die Städte deprimierend. Doch die Leute fühlen sich auf eine prekäre Art zugehörig. Sie bleiben in der Gegend, obwohl ihr Leben zur Hälfte scheitert. Entweder haben sie nicht die Mittel, oder sie verstricken sich in Verhältnisse, die ihnen nicht gut tun. Der Geburtsort wird zur Heimat durch die emotionale Beziehung der Menschen zu diesem Ort. Es geht um rein persönliche Erfahrungen, die mit einem Ort verknüpft werden. Die Menschen machen ja heute überwiegend standardisierte Erfahrungen und sehnen sich nach der einen besonderen Erfahrung. Die finden sie oft in der Kindheit, denn Kinder erleben noch Einzigartiges.
J.S.: So wird Heimat zum rein subjektiven Ort und kann als solcher nicht von anderen vereinnahmt werden. Indem man über Erinnerungen spricht, vergewissert man sich ja seiner Heimat – sie wird zu einer Geschichte. In Saša Stanišićs Herkunft ist Heimat als Erzählung, als Fiktion, wichtig. Sie konstituiert sich im Rückblick aus Erinnerungen, auch indem der Protagonist Plätze seiner Kindheit aufsucht. Das Gegenteil zeigt sich in der Großmutter: Sie ist dement, verliert ihre Erinnerungen und damit ihre Zugehörigkeit.
M.H.: Es geht bei ihm ja auch stark um die Auseinandersetzung mit dem eigenen prekären Status als Flüchtling und dadurch auch um ein Kriegstrauma. Schon in seinem Debüt Wie der Soldat das Grammofon repariert deutet der kindliche Protagonist die grausamen Kriegsbilder um und erzählt in einer märchenhaften Sprache Geschichten. Er erlebt, wie Nachbarn umgebracht werden, und bagatellisiert die Situation mit einer kindlich-naiven Sicht. Die Frage nach Heimat und Herkunft ist bei Stanišić unauflösbar. Der Roman macht verschiedene Angebote, bleibt aber in der Schwebe. Hinzu kommt die komplexe Familiengeschichte: Sind wir die Guten, sind wir die Bösen? Wohin gehören wir? Woher kommen wir?
J.S.: Diese Schwebe findet sich auch auf formaler Ebene am Ende – das in diesem Sinn sehr romantisch ist. Hier gibt es nicht nur ein offenes Ende, sondern die Steigerung zu verschiedenen Varianten. Der Leser kann sich in Analogie zu einem Pen-&-Paper-Rollenspiel eins aussuchen. Dabei reicht die Spannweite von realistisch bis wunderbar – Elemente, die im Roman vorhanden sind, werden verstärkt.
M.H.: Hier ist das wunderbare Moment ganz offensichtlich. Aber auch Scheuer erzählt nicht rein realistisch. Alles hat einen doppelten und dreifachen Boden. Er errichtet eine literarische Landschaft, die sich aus mehreren Orten zusammensetzt. Scheuer zieht mehrere Erzählstränge ein, die nicht in der Gegenwart spielen müssen. Es gibt z. B. immer ein naturgeschichtliches Moment, und Genealogien sind wichtig. Es geht immer um die gleichen Personen und Familien, woraus sich ein riesiges Geflecht ergibt. Es gibt die Ober- und die Unterwelt, es geht ja um ein altes Bergbaugebiet. Die Oberfläche ist realistisch, aber man erkennt, was fiktionalisiert ist.