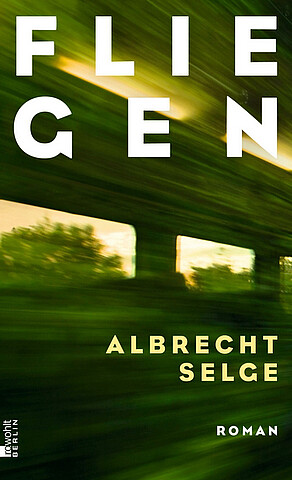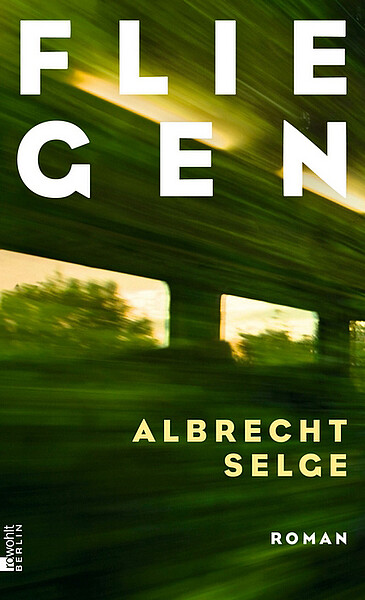Tag und Nacht im ICE – wo fängt die Romantik an und wo hört sie auf?
Sandra Kerschbaumer: Erst einmal erwartet man in Albrecht Selges Roman Fliegen überhaupt keine Romantik. Denn er handelt an einem besonders nüchternen Ort: in den Zügen der Deutschen Bahn, die wir mit der Protagonistin höchstens für einen kurzen Gang über einen Bahnsteig oder in eine Warte-Lounge verlassen. Die Heldin – das ist eine alternde Frau, die mit einer Bahncard 100 quer durch Deutschland fährt. Sie reist nicht, um an einem Zielbahnhof anzukommen, sondern sie lebt als Zugnomadin. Ausgestattet nur mit ihrem Ticket und einer schwarzen Tasche, die ihre Habseligkeiten enthält, geht sie durch den Zug und sammelt Pfandflaschen. Doch anders als viele flaschensammelnde „Unbehauste“, denen sie an den Bahnhöfen begegnet, hat sie sich für dieses Leben entschieden. Ich glaube, dass das Abstreifen aller festen Haltepunkte etwas mit einer tiefen Sehnsucht zu tun hat. Wir erfahren nach und nach, wovon sie sich im Leben gelöst hat: von ihrem Beruf, von verschiedenen Männern und Frauen. Es sind nicht nur schicksalhafte Wechselfälle, die sie loslösen, sondern es ist ein Gefühl, die Dinge nicht festhalten zu können, sich einer Bewegung, einem Sog hingeben zu müssen. Und diese Bewegung findet sie im Zug.
Franziska Wolffheim: Ich denke ebenfalls, dass die Heldin in einen ungewöhnlichen Sog geraten ist, der sie auch dann erfasst, wenn sie ganz selten „an Land“ geht, zum Beispiel beim Besuch ihrer Freundin, die in einer größeren Stadt lebt. Die Aufbrüche und überhaupt ihre unendliche Reise haben aber nichts Befreiendes, sondern eher etwas Düsteres, Getriebenes. Ich denke gerade an Eichendorffs Taugenichts, der heiter und unbedarft in die Welt zieht. Wie Selges Heldin sind ihm Konventionen und materielle Güter einigermaßen egal. Aber der Taugenichts findet am Ende seiner Reise das Glück, während es für Selges Heldin beides nicht gibt, weder das Glück noch ein definiertes Ende ihrer Fahrt. Bei Eichendorff heißt es am Ende (nicht ganz ironiefrei): „… und es war alles, alles gut!“
S.K.: Aber eine Sehnsucht teilen sie doch!
F.W.: Albrecht Selge spielt natürlich mit dem romantischen Motiv der Sehnsucht, aber er konterkariert es! Die Heldin sehnt sich – aber bei ihr reicht die Sehnsuchtsspanne vom All über die Kindheit bis hin zum belegten Brot. Es gibt also durchaus eine ganz profane Sehnsucht. Gelegentlich wird das Motiv ironisch gebrochen, wenn es zum Beispiel heißt: „Sehnsucht nach dem All wieder mal. Auweia.“ Auch an anderen Stellen flicht der Autor übrigens ein „Auweia“ ein, um etwa die von ihm zitierte romantische Poesie auf flapsige Weise zu kommentieren. Wenn man so will, nimmt Selge das auf Friedrich Schlegel zurückgehende Konzept der romantischen Ironie auf. Übrigens: Dass Selges Heldin querbeet alles liest, was ihr unterkommt, von der Lyrik der Romantiker bis zu Hera Lind, weist der romantischen Literatur, mit einem Augenzwinkern, eine gewisse Beliebigkeit zu.
Es gibt bei Selge aber nicht nur den humorvollen Umgang mit dem Sehnsuchtsmotiv, der Autor spielt auch mit dessen dunkler Seite, die auf den Tod verweist. An anderer Stelle heißt es über die Heldin: „Sie sehnte sich nach da, wo nichts sie anging.“ Die Sehnsucht nach dem Nichts, danach, aus Raum und Zeit herauszufallen ... . Dort, wo bei Eichendorff steht „und es war alles, alles gut!“, heißt es bei Selge: „Ihr unnützes Leben, denn es gibt keine Seele.“ Fast hätte ich jetzt gesagt: „auweia“ :-)
S.K.: Ich bin mir nicht so sicher, ob dieser letzte Satz eine feste Aussage ist. Eher glaube ich, dass er, wie viele andere Aussagen des Buches, in der Schwebe bleibt. Aber ganz bestimmt geht es um „Seelen“ – schon das Motto des Romans ruft ja: „Eilt, ihr angefochtenen Seelen“. Und tatsächlich sehen wir sie dann im Roman eilen, die Seelen, die Menschen, die unsere Heldin auf ihrer unendlichen, kreisförmigen Fahrtroute beobachtet: Telefonierende und Liebende, harte und freundliche Menschen. Die scharfe Beobachtungsgabe der Zugnomadin zeigt sie alle in einer „bösen Unruhe“. Selge schildert mit wenigen Strichen sehr gegenwärtige Menschen aus der Sicht einer Frau, die unbemerkt mitfährt. In ihrem Blick verschwimmt die äußere Welt der Mitreisenden, der vorbeifliegenden Landschaft vor dem Fenster mit ihrer eigenen inneren Welt. Wir kennen alle das Gefühl, wenn der Rhythmus der Fahrt die Gedanken langsam freisetzt. Hier wechseln mit den präzisen Beobachtungen Zustände, in denen das Denken schummrig wird, sich Assoziationen aneinanderreihen und manchmal in Traumsequenzen übergehen. Der Text verliert in solchen Momenten immer weiter an Halt, die Sätze werden unvollständig und sind nur noch lose miteinander verbunden. Die Heldin spürt ein „Versinken in der Gesamtheit der Dinge“. Im Zug mit seiner rasenden Bewegung scheinen die Zeit und die Unruhe kurz stillgestellt: „Alle Bahnhöfe, alle Züge, alle Tage, ewiges Einerlei“.
F.W.: Sicherlich bleibt das Ende des Romans in der Schwebe, aber aus dem Zusammenhang ergibt sich meiner Meinung nach eine eher düstere Grundierung von Verlorenheit. Die Heldin kann aus ihrer Position des Aus-der-Welt-geraten-Seins mit scharfem Basiliskenblick auf ihre Umgebung schauen, die Getriebenheit der „Seelen“ analysieren, wenn zum Beispiel jemand mit verkniffenem Gesicht auf sein Smartphone einhaut, als wäre der „Finger ein Krähenschnabel, der eine Schädeldecke aufhacken will“. Doch die Heldin bleibt eine Unerlöste. Sie ist im existentialistischen Sinne „in die Welt geworfen“. Diese Welt ist für sie „Geheimnis und Gleichgültigkeit“. Ihre Seele fliegt niemals „nach Haus“ (wie es in Anspielung auf Eichendorffs Mondnacht heißt). Das romantische „Geheimnis“ hat etwas Tröstendes, die „Gleichgültigkeit“ ist dagegen ein Aggregatzustand des modernen Erlebens. Der Heldin gelingt es kaum, Beziehungen zu ihrer Umgebung aufzubauen, häufig mauert sie sogar, wenn sie sich bedroht fühlt („Hau ab“). Ihr fehlt das, was der Soziologe Hartmut Rosa „Resonanz“ nennt: die Fähigkeit, Beziehungen zur Welt, etwa zu anderen Menschen oder zur Natur, zu knüpfen, in ihnen mitzuschwingen. Die Romantiker waren dagegen, im Sinne Rosas, Vertreter der Resonanz-Theorie avant la lettre, indem sie den Menschen als mitfühlenden Teil der Natur verstanden.
S.K.: Ja, zum Trost ist der Roman von Albrecht Selge wohl nicht so geeignet. Den Zustand von Verlorenheit sehe ich auch und die Zuspitzung des Gefühls, nirgendwo ankommen zu können. Es gibt keinen Aufbruch und kein Ziel, sondern nur noch eine zirkuläre Bewegung mit und in einem öffentlichen Verkehrsmittel. Schon bei Eichendorff, dessen Mondnacht-Zitat Selge ja über Seiten und Seiten und Seiten dehnt und wiederholt, heißt es ja „und meine Seele spannte/ weit ihre Flügel aus/ flog durch die stillen Lande/ als flöge sie nach Haus“. Auch hier ist vom Ankommen nicht die Rede – nur von der Möglichkeit. Auch bei Eichendorff und vielen der anderen durch das gesamte Buch hindurch zitierten romantischen Autorinnen und Autoren herrschen Zweifel, ob das resonante Aufgehen in der Natur oder in der Liebe oder einer Gemeinschaft einem modernen Menschen überhaupt möglich oder allein eine (poetische) Wunschvorstellung ist. Die Resonanzhürden scheinen sich in der Gegenwart weiter erhöht zu haben, aber der gelbe Reclam-Band mit den Gedichten bleibt doch der wertvollste Besitz der Heldin. Der Roman ist ja auch nicht von Hera-Lind-Zitaten durchzogen – auch wenn ich vielleicht einige übersehen habe :-)
F.W.: Das gelbe Reclam-Bändchen stellt in der Tat einen Fluchtort für die Heldin dar. Dabei ist aber die Verbindung zwischen dem romantischen Lebensgefühl und dem Lebensgefühl von Selges Heldin äußerst gering. Sicherlich gibt es in der Romantik den Zweifel, inwieweit das Ich überhaupt noch in der Welt aufgehen kann. Es gibt aber auch den Gedanken der fast mystischen Verzauberung, so wie in Eichendorffs berühmtem Gedicht Wünschelrute: „Schläft ein Lied in allen Dingen, / Die da träumen fort und fort, / Und die Welt hebt an zu singen, / Triffst du nur das Zauberwort.“ Das Zauberwort als Türöffner, um eine Welt zum Klingen zu bringen, die Möglichkeit kosmischer Entrückung statt profaner Alltagsrealität. Bei Selge finden wir eine weitgehend entzauberte Welt vor. Schon als Kind hat sich die Heldin oft vorgestellt, „sie wäre plötzlich verschwunden. Einfach weg. Die Welt ohne sie.“ In der Fantasie ist sie quasi aus der Welt gefallen. Auch ihre Dämmerzustände zwischen Wachen und Schlaf – ein typisches Schwellenmotiv der Romantik – sind häufig mit Verlust konnotiert und zudem auch eine körperliche Herausforderung. Nachtfahrten im ICE sind nicht besonders romantisch und bequem schon gar nicht! In Eichendorffs Mondnacht gibt es wenigstens den Konjunktiv, die Möglichkeit des Ankommens. Wer sich aber selbst tagtäglich und allnächtlich im Zug einsperrt, wird nie seine Flügel ausspannen können. Oder wenn, dann eben nur aus zweiter Hand, im Lesen romantischer Gedichte – auf denen sie oft aber auch ziemlich „herumkauen“ muss.
S.K.: Ja, die Verzauberung kann stattfinden, wenn man es denn trifft, das Zauberwort. Schon den Romantikern liegt die profane Alltagrealität gar nicht so fern. Das Naheliegende soll aber durch „Romantisieren“ mit einer anderen, höheren Welt verbunden werden, wenn ich „dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe so romantisire ich es“ – sagt Novalis. Und Friedrich Schlegel: „Das eigentlich Widersprechende in unserem Ich ist, daß wir uns zugleich endlich und unendlich fühlen“. Auch die Heldin von Albrecht Selge weitet die Welt des Pfandflaschensammelns, der ICE-Toiletten, des Backgammonspiels und Bordrestaurants aus und sucht nach einer Welt jenseits der nüchternen Beschränkungen. In Träumen und Halluzinationen herrscht eine ganz andere Wirklichkeit und Wahrnehmung: „In so ein schönes Dämmern fiel sie oft, wenn sie lange aus dem Fenster blickte. Das schönste plem im guten Sinn. Ging eins nahtlos ins andre über, kaum zu sagen, wo Hinausblicken aufhört und Hineinschauen anfängt: Dämmerstündchen zwischen Wach und Schlaf, in denen der Bildersalat aus Eindrücken und Erinnerungen zu hellen Träumen wird: Fernen der Erinnerung, Wünsche der Jugend, der Kindheit Träume kommen, des ganzen langen Lebens kurze Freuden und vergebliche Hoffnungen kommen in grauen Kleidern, wie Abendnebel nach der Sonne Untergang“.
F.W.: Und auf dieses Zitat aus den Hymnen an die Nacht folgt wieder ein „Auweia“!
S.K.: Es sind ja verschiedene Verse, die im Bewusstsein der Protagonistin und im Roman haften bleiben, auch solche, die die Gefährdungen der Menschen beschreiben, wie das „Wohin?“ aus Wilhelm Müllers Schöner Müllerin. Das Gedicht spricht von einem Wanderer und einer Bewegung, die nicht stillgestellt werden kann, die kein Ziel mehr kennt und damit das Ich an den Abgrund führt. Was passiert, wenn wir nicht mehr wissen, wohin wir uns wenden und wonach wir suchen? „Das Draußen fliegt der kleinen Frau davon. Diese geheimnisvolle und gleichgültige Welt“. Sie droht sich aufzulösen: Vielen Sätzen fehlt ein Subjekt und auch die Sätze selbst gehen ganz am Schluss in einen einzigen fünfseitigen Satz über, der alles miteinander verbindet, der allein durch die Wiederholung von „fliegen“ zusammengehalten wird. Ob die Welt ein Geheimnis verbirgt oder gleichgültig ist – das bleibt so unentschieden wie die Tragfähigkeit des Wortes „Seele“. Es bleibt nur die Bewegung und deshalb der Zug. Der Zug fliegt – dieser Zustand ist das Entscheidende, das Titelgebende, die Loslösung, der Rest bleibt ungewiss.
F.W.: Der Zug steht in diesem Fall aber auch für rasenden Stillstand, und eben dieser Stillstand macht die leicht depressive Befindlichkeit der Heldin aus. Der Zug suggeriert Bewegung, die in Wirklichkeit, im Leben der Protagonistin, aber keine Bewegung ist, denn die Heldin dreht sich bei ihren Bahnfahrten im wahrsten Sinne des Wortes im Kreis (dem entsprechen die oft langen, für die Leser fast unzumutbaren, kreisenden Sätze). Es fehlt der romantische Konjunktiv, die M ö g l i c h k e i t der Veränderung, die Verheißung des Zauberwortes. Oder in der Bildlichkeit des Romans: die Möglichkeit der rasenden B e w e g u n g und damit der Entfaltung der Persönlichkeit – anstatt rasenden Stillstands. Kann man da noch von Romantik sprechen?
Das Gespräch zwischen Franziska Wolffheim und Sandra Kerschbaumer wurde im November 2019 per E-Mail geführt.