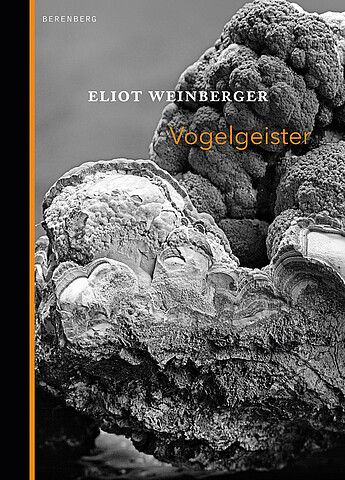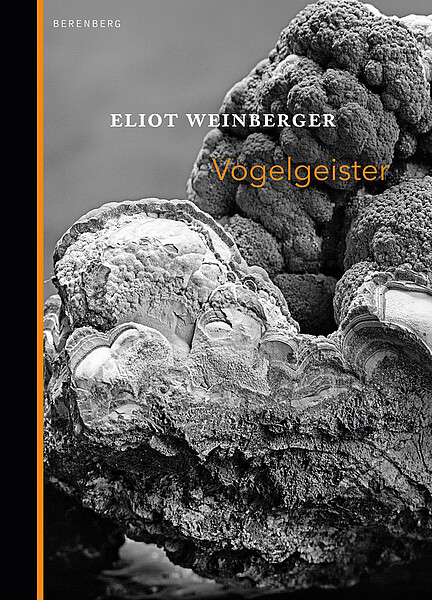Trüffel sind viel wirkmächtiger in der einfachen Küche als in der Haute Cuisine
Kai Sina: Wie sind wir eigentlich ursprünglich auf Eliot Weinberger gekommen? Ich erinnere mich daran, dass wir vor ein, zwei Jahren gemeinsam in Kiel in einem Café saßen und Du mich gefragt hast, welche Lektüre in letzter Zeit Eindruck auf mich gemacht hätte. Ich nannte Dir, ohne lang zu überlegen, Weinbergers seinerzeit neu auf Deutsch erschienenen Band Vogelgeister – und mir war in dem Moment gleich klar, dass Du das auch mögen würdest. Tatsächlich schriebst Du mir einige Woche nach unserem Treffen, dass Dich die Lektüre sehr begeistert hat, aber irgendwie sind wir später nicht mehr darauf zurückgekommen.
Arne Rautenberg: Ich weiß noch, wie Du von diesen interessanten Essays gesprochen hast, die so völlig anders sind. Ich war dann sehr überrascht, als ich das Buch zu lesen anfing. Denn das sind keine Essays im herkömmlichen Sinne, sie legen ihren Schwerpunkt so gar nicht auf Erklärungen, Kommentare etc. Diese Texte leben von zwei Dingen: Zum einen hat sich Weinberger als ein mentales Trüffelschwein quer durch Zeit und Raum auf zu raren Textquellen gemacht. Zum anderen hat er ein gutes Händchen fürs lockere, oft minimale Arrangement. Es ist, als ob plötzlich ein Lichtstrahl drauf fällt. Ich würde sagen, unterm Strich habe ich an der lyrischen Archaik erloschener Systeme, die sich in diesen Texten bruchstück- und zauberhaft manifestiert, Feuer gefangen. Da fallen en passant Sätze wie: „Es ist das grausame Recht von Himmel und Erde: mit Kälte zu töten.“ Da kann man dann als Lyriker nicht anders, als mit in den Strudel unvorstellbarer Absonderlichkeiten zu geraten. Weißt Du noch, welches Stück der Lektüre Dir im Gedächtnis geblieben ist?
K.S.: Die Archaik, das Interesse an uralten Überlieferungen, das hat mich ebenfalls gefesselt, zum Beispiel in dem Text Es war einmal in Albanien, in dem Weinberger einige Sätze aus dem Kanun, dem nordalbanischen Gewohnheitsrecht, kompiliert, das im 15. Jahrhundert kodifiziert worden ist, dessen Gesetze aber noch viel, viel älter sind. Unter der Überschrift „Gäste“ heißt es da zum Beispiel: „Einem hochrangigen Gast gibt man den Kopf eines Schafes, den er mit der Faust zertrümmert.“ Das ist auf den ersten, modernen, überheblichen Blick einfach nur kurios. Zugleich weist es aber darauf hin, was Menschen generell als soziale Konventionen zu akzeptieren bereit sind – und hier endet die Überheblichkeit auch schon wieder. Diese gewissermaßen doppelte Irritation, also die Begegnung mit dem Ultrafremden, das zugleich einen verfremdenden Blick auf das Eigene ermöglicht, finde ich aufregend und irgendwie auch, um es etwas pathetisch zu sagen, humanistisch bedeutsam. Weißt Du, was ich meine?
A.R.: Witzigerweise finde ich bei Weinberger das pathetische Vokabular völlig angemessen. Seine Essays fassen so entwaffnend-unverblümt an die Wurzeln der Menschheit. Und das ist einfach groß. Bezeichnend finde ich die Überlieferung, nach der ein Mädchen im Süden Indiens einmal im Jahr mit einem Frosch verheiratet wird. Das Hochzeitsritual zwischen Mädchen und Frosch wird voll durchgezogen, danach geht das Mädchen wieder in die Schule, als wäre nichts gewesen. Als ein indischer Journalist die Dorfbewohner fragte, warum sie das machen, hatten diese keine Antwort darauf. Es war halt schon immer so. Die Geschichte um den gekappten Anstoß eines Rituales scheint mir wie eine Metapher für das Leben selbst: Man lebt es, zieht es durch, nimmt es hin und mit – einfach so, im besten Fall als ein Geschenk. Mit unserer großen Metafrage „warum“ kommen wir da nicht weiter. Die Idee des Zulassen-Könnens ist mir seit jeher ein Motor, deswegen sind mir die Sphären von Kunst und Poesie ja auch so nah. Der Künstler Martin Kippenberger hat die vertrackte Absurdität des Ganzen mit seinem Bildtitel Nicht wissen warum, aber wissen wozu auf den Punkt gebracht. Daran muss ich oft denken, gerade auch bei der Lektüre von Weinberger.
K.S.: Dabei ist das Ganze von so einem Staunen getragen, als würde Eliot Weinberger mit jedem neuen kulturhistorischen Überbleibsel, das er aus den Archiven geborgen hat und nun den Leserinnen und Lesern präsentiert, sagen wollen: Schaut mal her, wie verblüffend, wie rätselhaft, wie unwahrscheinlich, das gab es auch einmal! Von einer romantischen Archivmelancholie, die man aus der deutschsprachigen Tradition, also etwa von den Brüdern Grimm kennt, ist dabei nichts zu spüren, oder? Weder geht es Weinberger darum, irgendwelche modernitätsbedingten Verluste zu betrauern, noch will er aus dem Überlieferten eine kollektive Identität ableiten. Wenn ich für seinen Ansatz einen Bezugspunkt in der Literaturgeschichte nennen sollte, wäre das für mich der späte Goethe mit seiner Zeitschrift Über Kunst und Altertum, die ebenfalls geprägt ist von einer programmatischen Vielstimmigkeit: In unterschiedlichsten Textformen kompiliert und kontrastiert sie Altes und Modernes, Bildkünstlerisches, Literarisches und Kritisches, Europäisches, Orientalisches, Asiatisches – und so fort. Diese sehr weit über den Tellerrand des sogenannten Westens und die Moderne hinausreichende Perspektive ist auch für Weinberger kennzeichnend, weshalb seinem Ansatz – keine Ahnung, ob er darauf abzielt, wahrscheinlich nicht – auch ein kritischer, sogar politischer Zug eigen ist: gegen eine narzisstische Fixierung auf die Gegenwart, gegen ein essentialistisches Verständnis von Identität.
A.R.: Den Vergleich mit Goethe finde ich sehr gut. Seine Idee, möglichst viel von der Welt umfassen zu können, was für Arme hat dieser Mann, bitte? Und nein, von einer Melancholie ist bei Weinberger nun wirklich nichts zu spüren, ganz im Gegenteil. Es ist ein triumphales Füllhorn, das er vor uns hinschüttet: Seht her, dies alles gab es also! Das führt bei unserem ja gern auch eurozentristischen Blick zu einem demütigen Nachleuchten, das empfinde ich genauso. Mir gefällt es, wenn Weinberger, und das macht er öfter, eine (Schein)Klammer sucht, in die er die bizarrsten Alltäglichkeiten bettet. Zum Beispiel versammelt er kleine Anekdoten und Geschichten rund um das Thema „Traum“. Dabei forstet er seine chinesischen Quellen nach dem Namen „Chang“ durch und versammelt auf ein paar Seiten quer durch die Jahrhunderte hindurch knappe Seltsamkeiten von träumenden Changs. Wie frech und erstaunlich konsequent, einfach einen Namen als Ordnungsprinzip zu benutzen! Halb ist es nah am Zufall gebaut, halb genau diesem Zufall entrissen. Und genau so lässt sich doch treffend etwas vom Wesen des Traums erfassen. Das Unvorstellbare, unseren zeitlichen und räumlichen Gewohnheiten Entrissene, wird als hier ein Geschenk offenbar. Und indem man das lesend erfährt, wirkt das auch wieder auf die eigene Existenz zurück: Denn was ließe sich über unser Kleinklein des Erlebens nicht auch alles berichten?
K.S.: Wichtig finde ich allerdings (Du hast schon darauf hingewiesen), dass sich Weinberger nicht im Kleinklein verliert, sondern das versammelte Material organisiert, und zwar sowohl auf der Ebene einzelner Texte wie auch im Gesamten, durch Kontrastierungen, Korrespondenzen, Leitmotive und so weiter. Der Band wirkt dadurch wie ein Ensemble, das man auf mindestens zwei Arten lesen kann: konventionell von hinten nach vorne im Ganzen, aber auch herumblätternd und verweilend an einer bestimmten Stelle, die einen besonders anspricht. Diese liberale Grundhaltung kommt mir als Leser entgegen, und ich finde diesen Ansatz auch sehr zeitgemäß. Was die Texte außerdem miteinander verbindet, ist der fast durchgehend nüchterne, sachliche Ton. Dabei unterscheiden sich die Grade der Poetisierung von Text zu Text sehr stark, was für die Übersetzerin Beatrice Faßbender eine riesige Herausforderung gewesen sein muss (die sie allerdings bravourös meistert): Auf der einen Seite stehen kulturhistorische Sammlungen etwa zur Bedeutung der Farbe „Blau“ in der Weltkultur, auf der anderen gibt es Rollen- und Geschichtsgedichte, in denen die Lesenden zu Flussfahrten auf dem Colorado und dem Amazonas mitgenommen werden. Was lässt sich daraus schließen? Vielleicht, dass kulturelle Überlieferung immer schon und unweigerlich mit Effekten der Variation, der Umdeutung und Neubewertung einhergeht? Das zeigt Weinberger ja gleich zu Beginn, in seinem zweiten Text, in dem er die griechischen, lateinischen, altslawischen und georgischen Fassungen der Genesis einander gegenüberstellt. Wer mag angesichts der doch sehr tiefgreifenden Unterschiede noch von Wahrheit, ja überhaupt von einer fixierbaren Bedeutung sprechen?
A.R.: Und das ist genau das, was ich an diesem poetischen Kompendium liebe: Jede neue Episode eine Überraschung! Eben warst du noch bei den Changs, plötzlich gibt es ein abgefahrenes Sammelsurium über Steine und wer wie wann was mit ihnen trieb. „Das Einzige, was chinesische Unsterbliche aßen, waren weiße Steine.“ Was für ein einleuchtendes, wahnsinnig schönes Bild! Und dann kommt eine einseitige Abhandlung über den Totenglauben der Mara, einem Stamm aus dem Nordosten Indiens; neue, bunte, ja fast unvorstellbare Rituale und Gedanken gehen damit einher. Ich habe überlegt, was meine poetische Arbeit mit der von Weinberger verbindet: Beide versuchen wir ja, über textliche Fragmente neue Tore zu öffnen, die den Gedanken- und Sehnsuchtsraum durchaus auch ins Transzendente zu erweitern vermögen. Doch es gibt einen entscheidenden Unterschied: Während Weinberger ein famoser Goldgräber in den Quellen der Menschheit ist und lauter Nuggets zu Tage fördert, bin ich eine Art Alchemist, näher an mir, am Formalen und am Scheitern, nicht so abgesichert, ein Visionär des Katzengoldes. Allerdings sehe ich es genau wie du: Wer will überhaupt noch von Wahrheit, ja überhaupt von einer fixierbaren Bedeutung sprechen? Die Poesie kennt immer neue Schleichwege um die Wahrheit herum – und, ein Paradoxon, kommt ihr dabei näher als auf dem geraden Weg darauf zu. Wenn man gerade auf die Wahrheit zuzugehen meint, erscheint sie zunehmend verschwommener im Nebel des Glaubens. Witzigerweise sind diese geraden Wege auf die Wahrheit zu tragendes Thema in vielen Weinberger-Episoden; doch erst die Summe all dieser tief empfundenen Annäherungen ans Wesentliche gibt den wahren Zauberblick ins Kaleidoskop. Und wenn man da hineinschaut, dann sieht man keinen Nebel mehr, sondern viele bunte, scharfe Kristalle. Oder anders gesagt: Aus Sicht der Leserinnen und Leser bleibt der Abstand ans Absolute gewahrt. Und jede Zeit, jede Epoche definiert ihre Abstandsregeln neu, sodass die Gesamtheit der nicht selten poetischen Umgänge der Menschheit mit ihrem tradierten Gedankengut und Ritualen stets Generator zur mentalen Teilchen-Beschleunigung bleiben darf.
K.S.: Interessanterweise spricht Eliot Weinberger selbst noch deutlich unverhohlener als Du vom Universellen und Absoluten, das sich in der Überlieferung als „undefinierbar lebende Materie“ erhalte und in der Lektüre „unmittelbar“ erlebbar werde (so, mit Blick auf das Gedicht, in dem Essay „Spuren des Karma“ in dem Band Kaskaden von 2013). Das hat fast schon eine kunstreligiöse Note, womit vielleicht tatsächlich eine Nähe zum Romantischen gegeben ist. Vor dem Hintergrunde dessen, was Du schreibst, stellt sich mir aber vielmehr die Frage, welche Rolle Weinberger als Autor hier eigentlich zukommt: Ist er „nur“ Sammler, wie man es dem guten Walter Kempowski in Bezug auf das Echolot(ungerechtfertigterweise) vorgeworfen hat? Vielleicht ist es eher so: Weinberger stellt sich in eine lange Reihe all jener, teils namenlosen (Nach-)Erzähler, ohne die es sein Buch nicht geben würde. Das macht ihn klein, nämlich in der völligen Abhängigkeit von der kulturellen Überlieferung, und groß zugleich: in seiner ganz erstaunlichen Aufnahmefähigkeit und Anverwandlungskraft. Goethe übrigens (um den Namen wirklich ein allerletztes Mal zu nennen!) hat sich in einem Gespräch kurz vor seinem Tod als „être collectif“ bezeichnet; diese dichterische Selbstauffassung trägt sich dann weiter bis zu Walt Whitman, der von sich im „Song of Myself“ sagt: „I contain multitudes“. Vielleicht lebt Weinbergers Autorschaft von dieser Idee einer Einheit in der Vielheit. E pluribus unum, sozusagen. Was das alles mit Deiner Kunst verbindet, ist für mich die Sensibilität und Offenheit für das Kleine, Ephemere, das Abgelegene und Abgelegte. Es gibt, anders gesagt, nichts, was nicht literaturwürdig wäre. Aber wo Weinberger ausgräbt und ausstellt (wozu es für ihn auch gehört, seine Quellen offenzulegen), erzeugst Du ein Funkeln und Leuchten, mal heller, mal dunkler, aber immer mit Impuls, das, was niedrig ist, ästhetisch groß zu machen.
A.R.: „Undefinierbar lebende Materie“, super. Frage: Wenn das Trüffelschwein auch noch Koch wäre – welche Küche wäre für das kochende Trüffelschwein angemessen? In meinen Augen sind die Trüffel viel wirkmächtiger in der einfachen Küche als in der Haute Cuisine. Einfach Trüffel über Nudeln reiben, fertig, reicht völlig, ist Zauberei. So kommen mir auch die Essays von Weinberger vor: Da braucht es kein großes Tamtam, keine breit ausgewälzte Story oder gar einen Romankonstrukt drumherum, keine lyrische Überhöhung. Die ans Licht geförderten Quellen glänzen und funkeln einfach so in ihrem Authentizitätsschein, möglichst schlicht, von allem Ballast befreit. Weinberger ist letztlich ein Befreier, oder? Er befreit etwas, das uns berührt. Und von dem wir gar nicht wussten, dass es das gibt. Irre. Irre schön.
Das Gespräch von Kai Sina und Arne Rautenberg wurde im Mai 2019 per E-Mail geführt. Textgrundlage ist Eliot Weinberger: Vogelgeister. Aus dem Englischen von Beatrice Faßbender. Berlin: Berenberg Verlag 2017. Der im Laufe des Gesprächs angeführte Text „Spuren des Karma“ findet sich in E.W.: Kaskaden. Essays. Aus dem Amerikanischen von Peter Torberg. Frankfurt am Main 2003.