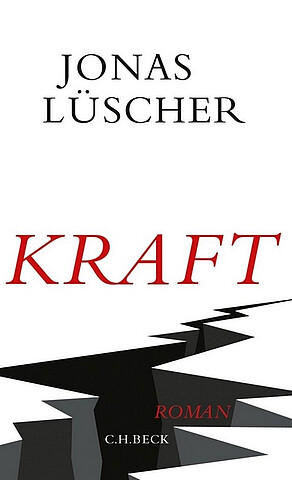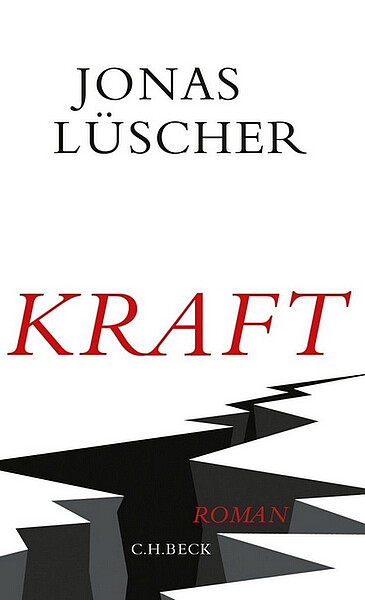Über Jonas Lüschers Roman „Kraft“
Sandra Kerschbaumer: In diesem melancholischen Roman stellt sich ein Tübinger Professor an der Stanford University der Beantwortung einer wissenschaftlichen Preisfrage, einer Frage, die an Leibniz angelehnt ist: „Weshalb alles, was ist, gut ist und wir es dennoch verbessern können.“ Richard Kraft sucht nach einer Antwort und wir sehen ihm dabei zu, wie er daran scheitert. Er sitzt in einer amerikanischen Bibliothek, schlendert über den Campus, wird immer unkonzentrierter, bis er zuletzt mit einer Schere an seinem Manuskript herumarbeitet, um einzelne Ideenfetzen zu retten. Sein langsames Scheitern wird unterbrochen von Rückwendungen. Die Gegenwart in den USA weicht immer wieder Krafts deutscher Vergangenheit seit den 1970er Jahren. Diese beiden Ebenen sind für das Buch wichtig, so ist es aufgebaut.
Daniel Grummt: Was ich spannend finde, ist, dass eine Preisfrage im Raum steht. Das hat ja eine große europäische Tradition, durch die im 18. Jahrhundert z. B. Rousseau überhaupt erst einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde. Hier, im Roman, ist es allerdings keine Wissenschaftsakademie, die eine Million für die Beantwortung einer drängenden Frage in Aussicht stellt, sondern einer aus dem Silicon Valley, ein Unternehmer namens Tobias Erkner. Kraft braucht dieses Geld, weil sein Familienleben zu Hause in Deutschland aus den Fugen geraten ist, seine Frau will sich trennen und er sich seine Freiheit von ihr und den Kindern erkaufen. Aber es geht nicht nur um Beziehungen allein, sondern ganz stark auch um historische Entwicklungen und um aktuelle politische Fragen. Das zeigt sich schon daran, dass die deutschen Kanzler im Roman von Lüscher zu Symbolfiguren ihrer jeweiligen Epoche werden: Willy Brandt und sein Kniefall, das Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt, der Aufstieg von Helmut Kohl.
S.K.: Ich glaube, dass der Roman von den beiden Ebenen lebt, den beiden erzählten Welten: Das persönliche und politische Leben der letzten Jahrzehnte wird dem Amerika der Gegenwart entgegengestellt und man fragt sich natürlich: Was haben die beiden miteinander zu tun? Mir scheint es so, dass die Idee, die beides zusammenhält, der Liberalismus ist. Aus diesem Fundus stammen – in politischer Hinsicht, in ökonomischer Hinsicht – die Ideen, von denen sich Kraft zeitlebens das „gute Leben“ versprochen hat. Wir sehen ihn schon als jungen Studenten – von den anderen belächelt bis verachtet – für den freien Markt, die Deregulierung, das Trickle-Down-Prinzip streiten. Das Problem ist, dass Kraft die von ihm verehrten Ideen in seiner Gegenwart praktisch umgesetzt sieht und nun Zweifel daran hat, ob das, was er immer für das Fundament des guten Lebens hielt, für ein solches eigentlich taugt. Deswegen erschüttert ihn die Preisfrage so. Jemand, der dachte, dass er weiß, wo seine politische und intellektuelle Heimat ist, merkt plötzlich: Vielleicht habe ich mich verrannt.
D.G.: Dazu passt auch etwas anderes gut. Die Figur Kraft bezieht sich ja ausdrücklich auf den politischen Philosophen Isaiah Berlin, der einen Essay Der Igel und der Fuchs geschrieben hat. Kraft wäre gern ein wendiger Fuchs wie ihn Berlin charakterisiert, verhält sich aber wie ein abwehrender Igel, der sich in ein System zurückgezogen hat. In den USA sieht er dieses System gewissermaßen in Vollendung. Es gibt da diese komisch-überdrehte Szene in einer Cafeteria, wo er sitzt und zwei Männer belauscht, die sich enthusiastisch darüber unterhalten, wie gut es ihnen geht, dass sie enorm viel Erfolg haben. Den einen von beiden treibt um, wie man Erfolg eigentlich effektiv messen kann, um zu wissen, wie man im Vergleich zu anderen dasteht. Sie denken darüber nach, eine App zum Erfassen von Erfolg zu entwickeln. Das ist ein Punkt, den der Autor Jonas Lüscher immer wieder berührt, hier, aber auch in Reden und Essays, die Tatsache, dass wir alles vermessen und quantifizieren wollen. Lüscher lässt Kraft darüber nachdenken, ob seine zeitlebens vertretenen wirtschaftsliberalen Ideen zu dieser Ökonomisierung des Denkens beigetragen haben. Die sieht er in den gar nicht unsympathischen, kantigen, braungebrannten Männern am Tisch verkörpert. Er sieht plötzlich die Verbindung von den Ideen, die er zeitlebens vertreten hat, zu den Resultaten, die nun vor ihm sitzen und in ihrer Vitalität und Selbstverliebtheit aus den Nähten platzen.
S.K.: Ich bin mir nicht sicher, ob das Buch liberale Grundsätze in Frage stellt oder nur deren igelartige Verhärtung. Der Igel ist derjenige, der eine Ordnung haben will und zwar nur eine. Es muss sich alles fügen zu einem Ganzen und der Fuchs ist so: Der schnürt durch die Gegend und sieht das Viele und nicht das Ganze, weiß auch, dass er es nie alles zusammenbringen wird, die ganze Widersprüchlichkeit dessen, was er wahrnimmt. Ich glaube, dass die Verzweiflung Krafts daher kommt, dass er merkt: Die Ideen, die ich hatte, haben sich irgendwann verfestigt, und ich habe es nicht geschafft, ein Fuchs zu bleiben. Es gibt ja eine Art Mantra, das den Roman durchzieht: „Nie ist es einfach, nie und nichts“ – das kommt in Variation immer wieder vor. Was so lapidar hingesagt wird, ist ja für den einzelnen Menschen und auch für die Gesellschaft eine fast verzweiflungsvolle Aussage, denn wie soll man leben, wenn man weiß, dass alles zu allem im Widerspruch steht. Dieses Beschwören der Komplexität erinnert mich an die soziologischen Gegenwartsdiagnosen von Armin Nassehi. In jedem Fall greift der Autor Lüscher auf eine erzählerische Ironie zurück, um sich vor igelartigen Verfestigungen zu schützen. Sein Protagonist Kraft beurteilt zwar die Welt, aber dürfen wir ihm eigentlich glauben? Er ist ein Schwafler und ein Scheiternder, der von einem sich immer wieder einschaltenden auktorialen Erzähler vorgeführt und auch belächelt wird.
D.G.: Ich weiß übrigens nicht, ob man Kraft als Helden oder eher als Antihelden sehen sollte. Auf mich wirkt er im Grunde absolut unsympathisch. Da gibt es die Schilderung mit dem Skiff in der San Francisco Bay. Er wird im Bootshaus der Universität darauf hingewiesen, er solle sich nach den Gezeiten richten und sein Mobiltelefon mitnehmen. Kraft versenkt jedoch sein Handy im Wasser, verliert das Ruder, kentert mit dem Boot und am Ende steht er völlig nackt da. Nur mit Seegras knapp bedeckt. Alles in allem macht er keinen glücklichen Eindruck und ist auch in moralischer Hinsicht nicht gerade ein Vorbild: Zum Beispiel verrät er seinen Freund und Weggefährten István, der durch ein Versehen zu Ostblockzeiten aus Ungarn geflohen war und dann zum glühenden Verteidiger des NATO-Doppelbeschlusses wurde – ein merkwürdiger Typ. Kraft verrät seinen Freund, indem er mit der Aktivistin Ruth Lambsdorff eine Liaison anfängt, obwohl eben jene Ruth auf einer Demonstration István durch den Schlag mit einer drahtumwickelten Gerbera um ein Augenlicht bringt. Kraft ist fasziniert von ihren breiten Hüften und sieht in ihr die mögliche Mutter seiner Kinder. Das ist sehr konstruiert, wie vieles übertrieben und dadurch komisch. Ganz typisch für den Roman.
S.K.: Es gibt drei Frauen in dieser Geschichte…
D.G.: Mein Eindruck ist, dass die Frauen die eigentlichen Heldinnen von Lüschers Roman sind. Auch wenn ihre Ansichten kaum dargelegt werden, sondern sie vielmehr aus der Perspektive Krafts oder nur im Gespräch mit ihm erscheinen, erfährt der Leser doch einiges über sie. Über Ruth zum Beispiel, dass sie Bildhauerin ist und sich erst nach einigem Zögern auf Kraft überhaupt einlässt. Die Frauen im Roman sind Figuren, die was riskieren und die vor allem mit der Kontingenz des Lebens besser umgehen können als Richard Kraft: Sie beenden Beziehungen, wechseln Orte und Lebensformen. Auch die zweite wichtige Frau im Roman, die Naturwissenschaftlerin Johanna, verfährt so. Sie lebt für ihre Hefekulturen und als ihr die Beziehung zu eng wird, geht sie nach Amerika (wo die beiden dann auch nochmal aufeinandertreffen). Die Frau, mit der er in der Gegenwart verheiratet ist, eine Expertin für Zahlen und Fakten, findet bei Kraft auch nicht das, was sie sucht. Denn nachdem sie Zwillinge mit ihm bekommen hat, will sie beruflich wieder einsteigen. Das sieht Kraft als Problem, da er für sie nur den privaten Bereich des Haushalts vorgesehen hat. Er nimmt die Frauen in ihrer Individualität gar nicht wahr, er nimmt ihre Freiheitsvorstellungen nicht ernst, obwohl er ein großer Schwadroneur freiheitlicher Vorstellungen ist.
S.K.: Ich finde es erstaunlich, dass die Frauen so wichtig sind, obwohl ihre Geschichten nicht ausgebreitet werden. Aber das ist es wohl gerade, was der Autor am Erzählen so schätzt, dass eine Erzählung Leerstellen und Freiräume lassen kann. Wir sehen diese Lebensläufe vor uns, ohne dass sie wirklich entrollt werden. Vielleicht ist es das, was der Autor Jonas Lüscher als die Wahrheit der Narration bezeichnet. Dass das Erzählen in der Andeutung von Widersprüchen mehr kann als eine philosophische Abhandlung. Wenn man kurz aufs Biographische abschweifet: Der Autor hat nach einer Ausbildung als Primarlehrer in der Schweiz in München Philosophie studiert und in einer Dissertation an der ETH Zürich begonnen, die gesellschaftsbeschreibenden Qualitäten des Erzählens zu erforschen. Heute lässt er uns im Nachwort seines Romans wissen, dass er diesen Plan aufgegeben hat und nun der Überzeugung ist, dass er durch das Erzählen selbst näher an die Dinge und die unterschiedlichen Wahrheiten herankommt, näher als durch das strukturierende, zwangsläufig verallgemeinernde Denken.
D.G.: Das ist die „Flucht ins Erzählen“, wie Lüscher es selber nennt. Im quantifizierenden Denken werden Typen gebildet und der einzelne Mensch verschwindet dahinter und den will er im Erzählen wieder sichtbar werden lassen – und sei es durch Andeutungen und das Auslegen von Spuren. So wie die Geschichten der Frauen angedeutet werden. Die Frage ist, ob das so aufgeht. Es ist, glaube ich, ein Trugschluss zu denken, dass Narrationen nun das Lösungsmittel gegen das Quantifizieren wären. Denn es kann durchaus sinnvoll sein, auf eine Typisierung zu setzen. Georg Simmel schreibt in der soziologischen Beantwortung der Frage „Wie ist Gesellschaft möglich?“, dass die Verallgemeinerung des Anderen notwendig ist. Er betont die Tatsache, dass wir uns gar nicht immer auf den Anderen einlassen können, weil ein Teil von uns unverfügbar ist und Menschen sich nicht immer bis ins Letzte (er)fassen lassen. Insofern besteht für uns im Alltag einfach eine Notwendigkeit, Typen zu bilden, um Situationen besser einschätzen zu können: Hier habe ich es mit einer Professorin zu tun und befinde mich in einer Vorlesung, wo ich mich entsprechend nach den Vorgaben des Settings zu verhalten habe, und dort mit einem Start-up-Unternehmer, mit dem ich wiederum anders umgehe.
S.K.: Natürlich ist es zu einfach zu sagen, wir müssten nur Erzählen und diese Art der Weltwahrnehmung gegen das Systematisieren setzen. Wir sind ja auch schon wieder dabei, die Fülle dieser Erzählung zu reduzieren, zu ordnen. Ohne Abstraktionen könnten wir darüber nicht sprechen und müssten uns gegenseitig den Roman vorlesen. Aber die Fülle und Genauigkeit der Erzählung sind eine große Stärke. An einigen Stellen erreicht der Roman die bildliche Kraft seines Vorgängers, der Novelle Frühling der Barbaren. So in der Landschaftsbeschreibung von Bair Island, dem von Kanälen durchzogenen Flecken Marschland, in dem Kraft mit dem Boot kentert. Das minutiöse Detail lässt sich in einer der Rückblenden studieren, in der wir die jugendlichen Freunde auf der Besuchertribüne des Bonner Bundestages sitzen sehen, wo sie das Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt miterleben. Sie hoffen auf den Anbruch einer neuen Ära. In der Haltung der einzelnen Akteure, in ihren kleinen Gesten, in ihrer Mimik spiegelt sich die große Politik.
Das Gespräch zwischen Daniel Grummt und Sandra Kerschbaumer wurde im Mai 2018 in Jena geführt.