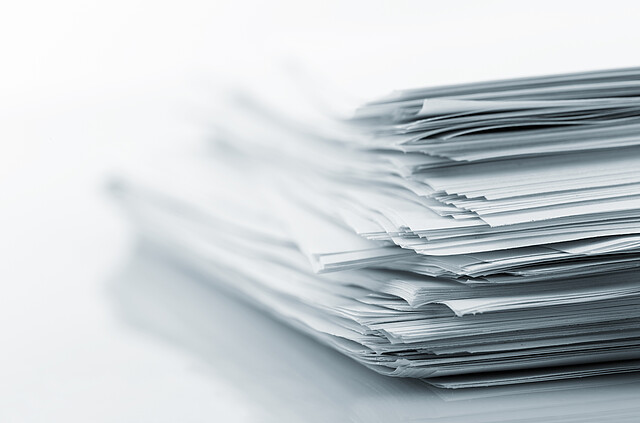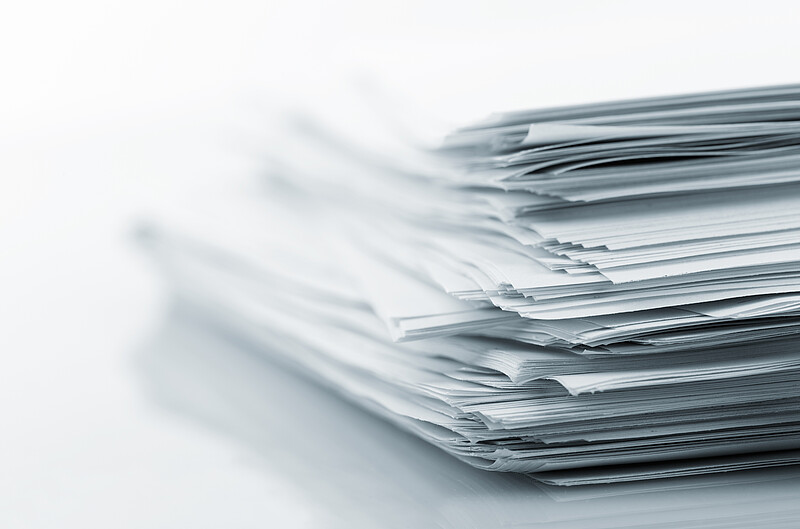Rückblicke auf die Romantik. Ludwig Tiecks Spätwerk – neu vermessen
Call for Papers zur wissenschaftlichen Tagung (24. bis 26. Juni 2026)
Freies Deutsches Hochstift / Goethe-Universität Frankfurt am Main
In den 1820er und 1830er Jahren erreicht die Romantik in Deutschland eine fast hegemoniale kulturelle Stellung und gewinnt auch international einen immer stärkeren Einfluss. Auch Ludwig Tieck (1773–1853) – eine ihrer Gründungsfiguren – zeichnet sich in seinen Dresdener Jahren durch eine immense Produktivität aus, die sein Spätwerk noch einmal zum Kulminationspunkt aktueller Debatten werden lässt. Viele Zeitgenossen prüfen an seinem Beispiel die Probleme und Potenziale einer ‚Romantik‘ unter veränderten Vorzeichen. Dabei scheint sich der Autor selbst allmählich von jener Diskursformationen zu distanzieren, die er maßgeblich mitgeprägt hat. „Nachher hat man mich zum Haupte einer sogenannten Romantischen Schule machen wollen“, beklagt er in einem Gespräch mit seinem Biografen Rudolf Köpke. Und er ergänzt mit Blick auf die Gegenwart: „Nichts hat mir ferner gelegen als das, wie überhaupt in meinem ganzen Leben alles Parteiwesen.“ (Köpke 1855, 173)
Zwar dienen solche rhetorischen Abgrenzungsversuche primär dazu, die Individualität des eigenen Schreibprojekt zu profilieren. Gleichzeitig aber geben sie einen Hinweis darauf, dass sich Tiecks Selbstverständnis in diesen Jahren verändert. Als ‚Zeitkritiker‘ nimmt er die veränderten Rahmenbedingungen literarischer Produktion zur Kenntnis (neue Gattungspräferenzen, ein abnehmender Stellenwert von Dichtung, ein ‚Operativ-Werden der Literatur‘) und überführt sie in eine ambivalente Strategie der Selbstevaluation. Alte Freunde und eigene Werke werden in seiner Novellenprosa mit ironischer Spielfreude zitiert, gleichzeitig aber wird eine romantische ‚Ästhetik des Hässlichen‘ für eine fatale Eigendynamik mitverantwortlich gemacht, mit der sich eine kunstferne Haltung ausbreite und mehr und mehr in eine anti-idealische Lebensrealität übersetze.
In Ludwig Tiecks Spätwerk werden romantische Schreibweisen einerseits weitergeführt, andererseits hinterfragt, historisiert und aktualisiert. In dem von ihm selbst wesentlich mitentwickelten Erzähltypus der Novelle führt er kritische Selbstreflexionen vor, die sich auf Brüche und Kontinuitäten mit dem eigenen Frühwerk befragen lassen. Zu prüfen wäre nun, in welchen Deutungshorizont dieses Nebeneinander von Bewahrung und Kritik zu stellen ist. Zeigt sich in Tiecks – von den Zeitgenossen und später auch von der Forschung abwertend bezeichneten – „Tendenznovellen“ ein Zug zur Operativität, der seine Texte mit denen seiner literarischen Widersacher verbindet? Wohnt dem Werk des späten Tieck vielleicht gar ein konstitutiver Selbstwiderspruch inne, der jetzt auch als Botschaft bzw. polemische Spitze in seiner Literatur installiert wird, um den zeitgenössischen Tendenzen einer zunehmend dogmatischen Eindeutigkeit ästhetisch, manchmal gar querulantisch entgegenzutreten? Oder prolongiert der Autor (früh-)romantische ästhetische Konzepte in die Vormärz-Zeit? Versucht er angesichts einer zunehmend materialistischer werdenden Gegenwart, die Errungenschaften der Kunstautonomie zu sichern, sie aber zugleich vor dem Umschlag in einen sozialfeindlichen Solipsismus zu bewahren?
Die geplante Tagung möchte das nach wie vor nur unzureichend erforschte und wegen der ihm innewohnenden gegenstrebigen Tendenzen hochgradig erklärungsbedürftige Dresdener Spätwerk Tiecks umfassend untersuchen und dabei insbesondere folgende Fragen behandeln:
- Wie ist das Verhältnis von Kontinuität und Diskontinuität in Tiecks späten Texten zu bewerten?
- Welche Rolle spielt der Erzähltypus der Novelle bei dieser Selbstbefragung?
- Wie erklärt sich das Nebeneinander von historischen Romanen („Dichterleben“, „Der Aufruhr in den Cevennen“, „Pietro von Abano“, „Der Hexensabbat“, „Vittoria Accorombona“), Künstlererzählungen („Dichterleben“, „Der junge Tischlermeister“) und in der Gegenwart angesiedelten Novellen („Der Wassermensch“, „Die Glocke von Aragon“, „Des Lebens Überfluss“, „Waldeinsamkeit“)?
- Wo grenzt sich Tieck von problematischen Erscheinungen der Romantik ab und in welcher Weise verteidigt er deren ästhetische Grundprinzipien?
- Wie ist Tiecks Anteil an der Entwicklung einer „Ästhetik des Hässlichen“ (Karl Rosenkranz)?
- In welcher Weise korreliert Tiecks Reaktion auf sein eigenes Älterwerden mit der Wahrnehmung des Alterns der romantischen Bewegung?
- Wie positioniert Tieck sich zur internationalen Romantik, beispielsweise mit Blick auf Frankreich (Victor Hugo, Gérard de Nerval)?
- Wie wäre der späte Ludwig Tieck zwischen Romantik, Vormärz und Frührealismus zu verorten?
Diese und weitere offene Fragestellungen sollen im Rahmen der Tagung erkundet werden, um die Konturen eines bislang unterrepräsentierten Aspekts von Tiecks literarischem Schaffen sichtbar zu machen. Themenvorschläge können bis zum 31. Oktober 2025 eingereicht werden. Gegenwärtig bemühen sich die Veranstalter um die Finanzierung der Veranstaltung. Eine Übernahme der Kosten für Reise und Unterkunft wird angestrebt.
Contact Information
Organisation und Leitung:
Prof. Dr. Wolfgang Bunzel
Leiter der Abteilung Romantik-Forschung
Freies Deutsches Hochstift/Frankfurter Goethe-Museum
Großer Hirschgraben 23-25
60311 Frankfurt a.M.
e-mail: wbunzel(at)freies-deutsches-hochstift.de
Dr. Raphael Stübe
Goethe-Universität Frankfurt am Main
Institut für deutsche Literatur und ihre Didaktik
Norbert-Wollheim-Platz 1
60629 Frankfurt a.M.
e-mail: Stuebe(at)em.uni-frankfurt.de