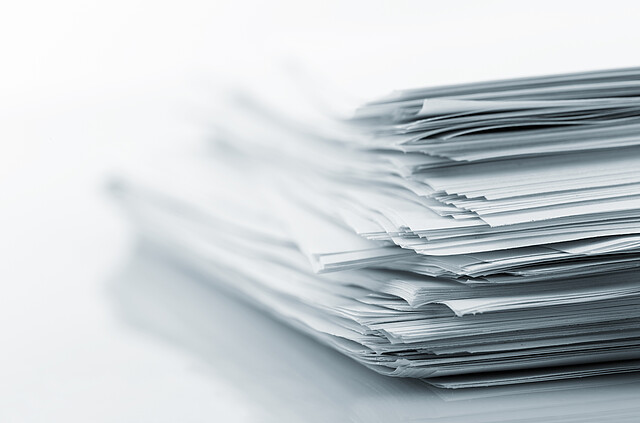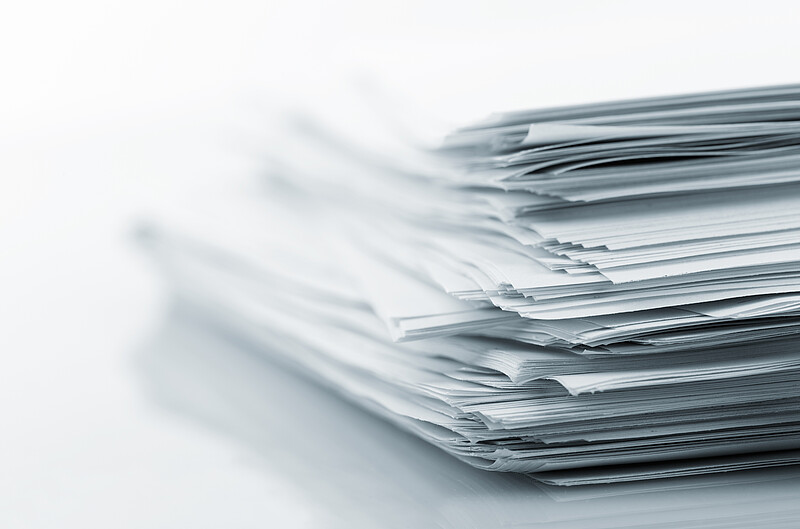Tagung: „Die Gegenwart der Romantik. Zeitreflexion und literarische Intervention um und nach 1800“
Jahrestagung der Friedrich-Schlegel-Gesellschaft, 18.-20. September 2023, Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald
Konzeption: Prof. Dr. Klaus Birnstiel und Prof. Dr. Eckhard Schumacher (Universität Greifswald)
„Die Französische Revolution, Fichtes Wissenschaftslehre, und Goethes Meister sind die größten Tendenzen des Zeitalters. Wer an dieser Zusammenstellung Anstoß nimmt, wem keine Revolution wichtig scheinen kann, die nicht laut und materiell ist, der hat sich noch nicht auf den hohen weiten Standpunkt der Geschichte der Menschheit erhoben.“ Was Friedrich Schlegel hier im 216. Athenaeums-Fragment formuliert, bringt auf den Punkt, wie sehr die Romantik an Zeitfragen ihrer Gegenwart interessiert war. Weit davon entfernt, sich angesichts der schockartigen Modernisierungseffekte um 1800 von ihrer Gegenwart grundsätzlich zu distanzieren und etwa einer Wiederkehr längst überkommener kultureller Konfigurationen der Vergangenheit das Wort zu reden, hat die Romantik, haben die Romantiker*innen lebendigen Anteil an ihrer Gegenwart genommen. Folgt man Schlegels Bemerkung, dann ging es der Romantik gerade nicht darum, die „Tendenzen des Zeitalters“ abzuweisen, sondern sie intellektuell zu durchdringen und Angebote zur Fortentwicklung der geistigen und kulturellen Situation der Zeit zu entwickeln. Romantik als Impuls für die Moderne zu begreifen bedeutet vor diesem Hintergrund, sich vor Augen zu führen, wie sehr sich die Romantik mit ihrer eigenen Gegenwart auseinandergesetzt, auf diese reagiert und in sie interveniert hat. Karl Heinz Bohrer hat in diesem Sinne betont, es sei „eine der nicht mehr rückgängig zu machenden Entdeckungen der deutschen Frühromantik, ‚Gegenwart‘ zu denken, das heißt, die Vorstellung von der Gegenwart gegenüber einer fälschlich objektivierten Tradition behauptet zu haben“. Die Tagung „Die Gegenwart der Romantik“ setzt sich entsprechend das Ziel, die Romantik in ihrer eigenen Gegenwart als Auseinandersetzung mit dieser neu zu konturieren – und damit jene Deutungen zu korrigieren, welche die Romantik weiterhin als letztlich reaktionäre, mindestens aber ins Zwielicht deutscher Sonderwegs-Thesen zu setzende Abwendung von Aufklärung, Vernunft und Modernisierung verbuchen.
Drei mögliche Fragekomplexe und Zugänge zur Gegenwart der Romantik zeichnen sich ab: zum ersten sind die spezifischen Zeit-, Geschichts- und Gegenwartsbegriffe herauszuarbeiten, derer sich die Romantik in ihren verschiedenen Phasen und Ausprägungen bedient hat; zum zweiten ist der Frage nachzugehen, welche literarischen und publizistischen Schreibweisen die Romantik entwickelt, um selbst an ihrer Gegenwart teilzunehmen und diese zu transformieren; zum dritten ist zu verfolgen, welche Aktualisierungen die Gegenwart der Romantik in jeweils ganz anderen Gegenwarten des 19., 20. und 21. Jahrhunderts erfahren hat und weiterhin erfährt. In allen drei Hinsichten bildet dabei nicht nur das ideengeschichtliche Potential der Romantik, sondern vor allem seine literarische und publizistische Ausprägung den entscheidenden Fragehorizont.
(1) Die tiefgreifenden Veränderungen der Wirtschaftsweise, des sozialen Zusammenlebens und der politischen Konfiguration Europas, aber auch der ideengeschichtlichen und philosophischen Konstitution der Gegenwart um 1800 sind nicht nur von Angehörigen der Romantik als Erfahrungen fundamentaler Brüche und Neuanfänge begriffen worden. Vielmehr lässt sich sagen, dass die Transformationserfahrungen des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts allererst ein Zeitbewusstsein inauguriert haben, das die ehedem als überzeitlich empfundene Kontinuität der menschlichen Erfahrung in ein historisches Denken von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zergliedert – und innerhalb dieser ‚historischen Zeit‘ (Koselleck) der Gegenwart einen privilegierten Platz einräumt. Nicht von ungefähr hat die Romantik ein umfangreiches historisches Denken entwickelt, das den vormodernen Antiquarismus hinter sich lässt und an seiner Statt nach historischen Entwicklungslinien und Erbschaften fragt, die zur Bestimmung der eigenen Gegenwart sich als fruchtbringend erweisen sollen. Herauszuarbeiten sind also das historische wie das gegenwartsbezogene Zeitverständnis der Romantik, ihre Konzepte und Begriffe von Geschichte und Gegenwart und ihre entsprechenden Versuche der Erfassung, Darstellung und Vermittlung von Zeiterfahrung und Gegenwartserleben.
(2) Lässt sich die Romantik als spezifische, in sich aber auch ebenso vielgestaltige epistemische Konfiguration der Gegenwart um und nach 1800 verstehen, so drückt sich ihre Beteiligung an der Auseinandersetzung um diese Gegenwart in einer ebenso großen Vielfalt literarischer und publizistischer Interventionsformen aus. Machen August Wilhelm und Friedrich Schlegel gleich mehrfach als Zeitschriftengründer von sich reden und greifen als Kritiker literarischer Texte und kultureller Figurationen sowie als geschichtsbewusste ästhetische Theoretiker in den Diskurs ein, bedienen sich Autor*innen wie Achim von Arnim, Clemens Brentano, Karoline von Günderrode und Ludwig Tieck explizit literarischer Schreibweisen, mit denen sie auf Gegenwartsverhältnisse und Zeitfragen reagieren. Neben der kritischen Publizistik und der Literatur der Gegenwart der Romantik bildet sich ein philosophisches und akademisches Schrifttum der Arbeit an der Gegenwart auf historischer und philologischer Grundlage heraus, für das etwa die Namen der Brüder Grimm oder Adam Müllers exemplarisch stehen. Zu fragen ist demgemäß nicht nur nach der Vielfalt, sondern auch nach dem Innovationspotential gegenwartsbezogener Schreibweisen der Romantik, ihren gattungsspezifischen Entwicklungen und medialen Transformationen.
(3) Romantik als Arbeit an der Gegenwart zu begreifen, legt darüber hinaus nahe, Aktualisierungsbemühungen dieser romantischen Gegenwart zu anderen Zeiten und unter veränderten epistemischen Konstellationen zu verfolgen. So wurde und wird das ‚Erbe‘ der Romantik immer wieder in gänzlich andere Zeitverhältnisse gesetzt und als Alternativangebot zur Lösung je spezifischer Zeitprobleme präsentiert. Zu denken ist hier etwa an die neuromantische Bewegung um 1900, den politischen Konservatismus des 20. Jahrhunderts und die Besinnung auf romantische Entgrenzungsprogramme im Zeichen des Poststrukturalismus, aber auch an Rückgriffe und Aktualisierungsversuche in der Mediengegenwart des 21. Jahrhunderts. Gefragt werden kann in diesem Sinne auch nach dem Nach- und Weiterleben romantischer Denkfiguren und Motive in Zeiten, die sich selbst ebenso als Umbruchszeiten begreifen wie die Romantik. Und schließlich steht auch die ungebrochen fortwirkende Attraktivität literarischer Schreibweisen der Romantik im Raum, wie sie sich etwa bei Rainald Goetz, Felicitas Hoppe, Christian Kracht oder Clemens J. Setz finden lassen.
Den skizzierten Problemzusammenhängen und Fragen widmet sich die internationale wissenschaftliche Fachtagung, die als Jahrestagung der Friedrich-Schlegel-Gesellschaft vom 18.-20. September 2023 am Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald stattfinden wird. Beitragsvorschläge im Umfang von bis zu 3000 Zeichen, verbunden mit einer kurzen bio-bibliographischen Notiz, werden als PDF-Dokument per E-Mail bis zum 6. Dezember 2022 erbeten an
J.-Prof. Dr. Klaus Birnstiel (klaus.birnstiel(at)uni-greifswald.de) und Prof. Dr. Eckhard Schumacher (eckhard.schumacher(at)uni-greifswald.de).
Die Vorschläge sollen jeweils mindestens einem der genannten Fragebereiche zugeordnet sein. Die Beiträge werden bis Mitte Januar 2023 ausgewählt. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in frühen Karrierephasen werden nachdrücklich zur Beteiligung aufgerufen. Eine Übernahme der Reise- und Übernachtungskosten wird angestrebt. Eine anschließende Publikation ausgewählter Tagungsbeiträge im Athenäum. Jahrbuch der Friedrich-Schlegel-Gesellschaft ist vorgesehen. Zudem sind im Rahmen der Tagung Posterpräsentationen für Promotions- und Forschungsprojekte geplant, für die im Januar 2023 eine gesonderte Ausschreibung folgen wird.