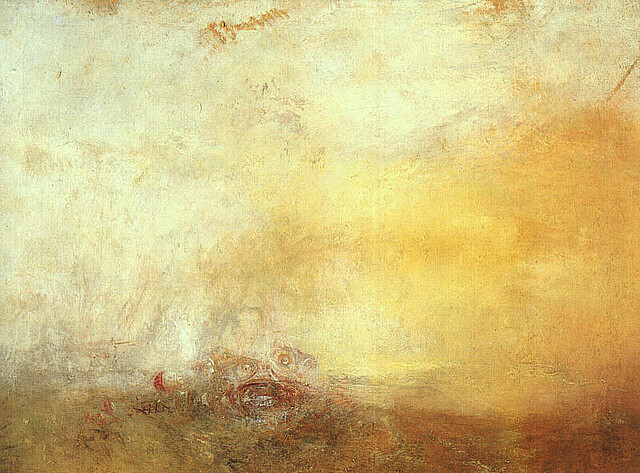Gespürtes Jenseits
Problemskizze
„Sie verstand ihn nicht“ [1] – so heißt es in Theodor Storms früher Novelle Immensee (1849), die zum Kanon der Epoche des deutschen Realismus zählt. Die Rede ist hier von der irritierten Elisabeth, die sich von ihrem Jugendfreund Reinhart Werner nichts weiter wünscht als das erlösende Wort der Liebe. Doch obwohl die beiden seit Kindestagen füreinander bestimmt zu sein scheinen, kommt es nie zur glücklichen Zusammenkunft. Reinhart kann sich nicht verständlich machen und so kommt es, dass Elisabeth nach einigen Jahren den Avancen des kapitalistischen Großbauers Erich nachgibt. Ähnlich wie Elisabeth steht auch die Literaturwissenschaft vor einem Rätsel: Warum kann sich Reinhart nicht mitteilen, obwohl sie ihm doch „der Ausdruck für alles Liebliche und Wunderbare“ [2] ist?
Der Text gibt darauf verschiedene Antwortmöglichkeiten. Bisher kaum berücksichtigt wurde Reinharts Hang zum Romantischen: Er ist Leser von Märchen, hat ein Faible für die „Urtöne“ [3] der Volkslieder und findet in einer weißen Wasserlilie das Symbol für die geliebte Elisabeth. Doch als er zur Lilie schwimmt kommt es ihm vor, „als ob die Entfernung zwischen ihm und der Blume dieselbe bliebe“. [4] Mit der Anspielung auf die Traumsequenz aus Novalis‘ Romanfragment Heinrich von Ofterdingen findet der Text ein Zeichen für die „unendliche Annäherung“ [5] und weist Reinhart als einen ewig Suchenden aus. Seine inneren Beweggründe kann er allerdings einmal mehr nicht erklären: „‚Wo sind denn Sie so spät in der Nacht gewesen?‘ rief ihm die Mutter entgegen. ‚Ich?‘ erwiderte er; ‚ich wollte die Wasserlilie besuchen; es ist aber nichts daraus geworden.‘ ‚Das versteht wieder einmal kein Mensch!‘ sagte Erich.“ [6] Immensee hat einen Sehnsüchtigen zum Helden, der immer wieder über eine Symbolsprache kommuniziert, die in der prosaisch verwalteten Welt Erichs unverständlich bleibt.
Man kann dieses Problem mit Überlegungen von G. W. F. Hegel kurzschließen, der die romantische Subjektivität als Lebensform, wenn auch vereinseitigend und polemisch überspitzt, in seinen Vorlesungen über die Ästhetik diskutiert. [7] Die Sehnsucht wird dort als kränklicher Ausdruck einer leeren Subjektivität präsentiert, die ein Inneres als ersehntes Äußeres setzt und damit in einer kreisförmigen „Einsamkeit und Zurückgezogenheit in sich“ [8] gefangen bleibt. Das Subjekt, so der Vorwurf, interessiert sich nur für sich und anverwandelt sich die Welt beliebig nach Lust und Laune. Als Reinhart seiner Jugendfreundin Essen beschaffen soll, führt er sie in eine Waldlichtung und überhöht ihre Gestalt poetisch zur ‚goldenen Waldeskönigin‘: „‚Mir graut!‘ sagte sie. ‚Nein‘, sagte Reinhart, ‚das muss es nicht. Hier ist es prächtig.‘“ [9] In seiner selbstbezüglichen Kunstemphase fehlt dem verzückten Helden der Blick für die Bedürfnisse der verängstigten Elisabeth und die ihm aufgetragenen Pflichten. Immensee lässt sich so als romantikkritischer Text lesen, der das Romantische mit Semantiken der Unverständlichkeit, Verantwortungslosigkeit und Weltferne korreliert. Die realistisch genannte Literatur ab der Jahrhundertmitte kann nicht hinter das Wissen um die Subjektivität von Wirklichkeitserfahrungen zurückfallen. [10] Doch sie findet Formen, die zumindest den Anspruch erheben, das vorgeblich Relative und Willkürliche in der romantischen Dichtung ästhetisch zu korrigieren.
Geheimnisvolle Klänge
An exponierter Stelle, nämlich im Vorwort zur Lyrik-Anthologie Hausbuch aus deutschen Dichtern seit Claudius, legt Storm ein sensualistisches Ästhetik-Konzept vor, das sich zunächst durch einen Bruch mit der mittelbaren Reflexivität auszeichnet:
Wie ich in der Musik hören und empfinden, in den bildenden Künsten schauen und empfinden will, so will ich in der Poesie, wo möglich, alles Drei zugleich. Von einem Kunstwerk will ich, wie vom Leben, unmittelbar und nicht erst durch die Vermittelung des Denkens berührt werden; am vollendetsten erscheint mir daher das Gedicht, dessen Wirkung zunächst eine sinnliche ist, aus der sich dann die geistige von selbst ergibt, wie aus der Blüthe die Frucht. [11]
Der Poesie wird die Ermöglichung einer synästhetischen Erfahrung beigemessen, denn in ihr treffen Qualitäten von Musik und bildender Kunst gleichermaßen zusammen. Dabei soll sich der ‚Sinn‘ nicht erst durch die gedankliche Vermittlung, sondern zuerst durch eine unmittelbare Sinnlichkeit einstellen. Wie vom ‚Leben‘ verlangt Storm auch von der Dichtung, dass sich die geistige Wirkung ‚wie von selbst‘ ergibt. Hier, wie auch in weiteren poetologischen Äußerungen, greift er dafür auf Begriffe aus dem Wortfeld ‚Natur‘ zurück. In der Naturbegrifflichkeit artikuliert sich einmal die geforderte Unmittelbarkeit des unverstellten Ausdrucks, zum anderen verbindet sich mit der erhöhten Gegenständlichkeit der Außenwelt ein epistemisches Profil, das die leibliche Sinnlichkeit als „vernünftige Grenze der Subjektivität“ [12] funktionalisiert. So entsteht eine konkretere Lyrik, die Thomas Mann „geheimnisvoll romantisch“ nennt und zugleich vom „Materialismus“ [13] des 19. Jahrhunderts beeinflusst sieht. Wie Storm sinnliche Qualitäten literarisch betont, kann das Gedicht Meeresstrand von 1856 illustrieren:
Ans Haff nun fliegt die Möwe,
Und Dämmerung bricht herein;
Über die feuchten Watten
Spiegelt der Abendschein
Graues Geflügel huschet
Neben dem Wasser her;
Wie Träume liegen die Inseln
Im Nebel auf dem Meer
Ich höre des gärenden Schlammes
Geheimnisvollen Ton,
Einsames Vogelrufen –
So war es immer schon
Noch einmal schauert leise
Und schweiget dann der Wind;
Vernehmlich werden die Stimmen,
Die über der Tiefe sind [14]
Am Strand steht ein Ich, das sich dem Blick auf das Wattenmeer hingibt. ‚Haff‘, ‚Dämmerung‘ und ‚Abendschein‘ veranlassen eine weite Perspektive über die gesamte Kulisse und sorgen für Raumtiefe, die eine bildliche wie innerliche Entgrenzung motiviert. Die beiden ersten Strophen fördern die Blicklenkung durch eine Raumdeixis, die einzelne Bestandteile in der Landschaft genau platziert (‚Ans‘, ‚Über‘, ‚Neben‘, ‚auf‘) und so den Eindruck von wirklichkeitsgetreuen Positionen und Abstandsverhältnissen erzeugt. Während Storm das Gekünstelte, Zerfahrene und die „willkürlich“ [15] aneinandergereihten Bilder in der romantischen Dichtung kritisiert, ist seine Landschaft durch eine Totalschau detaillierter aber zusammenhängender Bildelemente gekennzeichnet.
Dennoch knüpft das Gedicht unverkennbar an eine spätere Romantik an, nämlich an die Simplizität der Volksliedstrophen nach dem Modell Eichendorff und anderen sowie an eine Unbestimmtheitssemantik des Geheimnisvollen: „Seine Weltansicht, durchaus wissenschaftlich in Richtung und Inhalt, wies doch immer auf das Unergründliche hin, als die Wurzel alles Ergründlichen“ [16], so der Freund Ferdinand Tönnies. Das lyrische „Geheimnis“ [17] liegt Storm zufolge nicht in der konventionell festgelegten Wortbedeutung, vielmehr verortet er seine Wirkung auf Ebene eines transzendenten Klangs. Ganz auf Linie frühromantischer Musikästhetik schreibt er in einem Brief an Hartmut Brinkmann: „In den Worten liegt nur der Sinn des Gedichts; die Seele aber, die Musik, die Anmut, die liegt zwischen den Worten; in ihrer Stellung, in ihrer Verbindung, das ist ganz ungreifbar; und daher bedarf der lyrische Dichter des feinsten Gefühls und Gehörs.“ [18] Vor allem den Romantikern sei die Leistung anzuerkennen, die Evokation von „Stimmung“ [19] in die deutsche Literatur eingeführt zu haben, in der Merkmale von Innerlichkeit und Musikalität zusammentreffen. [20] Zumal Eichendorffs Dichtung führt Storm zufolge „in die tiefen Gründe […], welche erst nach Göthe die Romantik gefunden hatte.“ [21]
Eine esoterische Unergründlichkeit mittels sinnlich wahrnehmbarer Klänge weist auch das Gedicht Meerestrand auf – insbesondere ab der dritten Strophe, in der ein Umschlag vom Modus des Sehens zum Hören erfolgt. Denn mit dem Wechsel der Sinneswahrnehmung ist eine sukzessive Verworrenheit der Bilder korreliert: ‚Möwe‘, ‚graues Geflügel‘, dann ‚Vogelrufen‘, bis schließlich nur noch ‚Stimmen‘ zu hören sind, von denen sich nicht sagen lässt woher sie kommen und was sie mitteilen. Zumindest an diesem abseitigen Ort am Meer erscheint das Eingebunden-Sein in einen sinnvollen Gesamtzusammenhang, in die „letzten Ursachen“ [22] der Natur, noch möglich. Allein die Stimmen aus dem Jenseits sind durch ihre verworrene Pluralität und rauschende Störakustik der [ʃ]-Laute auf eine leibliche Spürbarkeit reduziert und bleiben semantisch vollkommen unbestimmt: Wo die Stimme Gottes einstmals noch einen festen religiösen Sinn garantieren konnte, [23] da löst sie sich jetzt in eine unentwirrbare Pluralität auf, verliert ihren Referenten und lässt eine Leerstelle zurück, die man mit Recht gespenstisch nennen kann. [24] So impliziert dieses gespürte Jenseits eine romantische „Kippfigur zwischen Behauptung und Wiederruf“ [25], modifiziert sie aber materialistisch bzw. sensualistisch, sodass sie nicht rein aus subjektiver Kraft heraus, sondern durch die leibliche Wahrnehmung äußerlicher Phänomene beglaubigt wird und so eine festere Grundierung in der Immanenz erhält.
Erlebnis
Der wohl spannendste poetologische Terminus Storms für die Beschreibung dieser sinnlichen Ästhetik ist das „Erlebnis“ [26], in dem sich der vermeintlich präreflexive Weltzugang des Subjekts abbildet. Mit ihm wird eine ästhetische Evidenzkategorie eingeführt, der sich die Einbildungskraft unterstellen muss: Die Welt kann nicht durch freie Imagination verzaubert werden, sondern soll mit der Wahrscheinlichkeit individueller Erfahrung im Leben kombiniert werden. Den vorgeblich nach-romantischen Auftritt des Erlebnisbegriffs hat die Begriffsgeschichte ermittelt, denn ‚Erlebnis‘ findet erstmals gehäuft ab den 1830er Jahren Verwendung und damit in einer Zeit, in der sich im Zuge von Verwissenschaftlichung und Liberalisierung zunehmend eine Abkehr von philosophischer Spekulation und eine ‚Wende‘ zur Lebenspraxis beobachten lässt. [27] Die Relevanz dieser Kategorie für Storms Literatur hat die Forschung indes meist übersehen. Das hat mindestens zwei Gründe: Erstens universalisiert sich der Erlebnisbegriff nach Wilhelm Dilthey, erhält seinen ontologischen Kern im Autoreninneren und verschwimmt so mit ‚Kunst‘ allgemein. Jedes Gedicht wäre dann also potenziell Erlebnislyrik. [28] Damit eng verbunden ist, zweitens, die fachgeschichtliche Reaktion des Strukturalismus. Indem er gegen den starken Autorbegriff einer ‚klassischen Hermeneutik‘ argumentiert, haben strukturanalytische Studien das unter Biographismusverdacht gestellte ‚Erlebnis‘ zugunsten vorgeblich objektiverer Textmerkmale verabschiedet. Persönliche Autorenerlebnisse sind empirisch nicht überprüfbar und folglich auch nicht von literaturwissenschaftlichem Interesse. Damit unerkannt bleibt, dass der metasprachliche Erlebnisbegriff im ästhetischen Kontext selbst mit den Textstrukturen verbunden ist und bei Storm wohlmöglich überhaupt erstmals, wenn auch noch äußerst schwach theoretisiert, in den Diskurs der Literatur Einzug erhält. Er bietet sich an, um ‚Realität‘ nicht rein spekulativ vom selbstbezüglichen Ich aus zu begründen, sondern in eine Beziehung zu äußerlichen Faktoren zu stellen.
In einem Brief an Eduard Mörike erwähnt Storm einmal, dass er als Kind ein besonderes „Erlebnis“ [29] hatte. Seine biografische Anekdote, er sei früher einmal in einen märchenhaften Wald geraten, hat er anschließend zum Gedicht Waldweg verarbeitet: Das relativ lange einstrophige Gedicht, das teilweise auch an Mörikes Die schöne Buche erinnert, ruft eine ganze Palette an starken Sinneseindrücken wie „Tannenharzgeruch“ oder „Sonnenduft“ auf und in den letzten vier Versen kommt es auch hier zu einer leiblich gespürten Jenseitserfahrung:
Schon streckten dort gleich Säulen der Kapelle
Ans Laubgewölb die Tannenstämme sich;
Dann war‘s erreicht, und wie an Kirchenschwelle
Umschauerte die Schattenkühle mich. [30]
Ähnlich wie im vorigen Gedicht bleibt unklar, was eigentlich ‚erreicht‘ ist. Verkompliziert wird die Lage weiterhin dadurch, dass dieses Gedicht den Untertitel Fragment trägt und damit in romantischer Manier eben kein Erreichen eines letzten Ziels gemeint sein kann. [31] Das überschneidet sich mit der geheimnisvollen Bedeutung dieser letzten Verse: Auch hier wird das Ich von einem Schauer erfasst, der im Verbund mit den Stämmen, der Schwelle und dem Schatten eine klangliche [ʃ]-Laute des Rauschens evoziert, wie man es aus Eichendorffs Lyrik kennt. [32] Das wird verbunden mit einer sakralen Semantik, die im letzten Vers noch durch einen Anstieg der Vokalhöhe vom [u] über das [a] zum [i] in jenseitige Sphären gehoben wird. Das ‚Erlebnis‘ beruht nicht auf der freien Produktivität des Subjekts, sondern hat die Funktion einer Rückbindung des Jenseitigen an die leiblich-sinnliche Erfahrung und die tröstende Kindheitserinnerung, für die Thomas Mann einmal die romantische Formel „Heimweh als Transzendenz“ [33] gefunden hat.
Ausblick
Als Reinhart an einem „Spätherbstnachmittag“ langsam nach Hause schlendert, ist er nicht mehr jung, sondern wird als der „Alte“ angeführt – seine Jugendemphase für das Romantische gehört jetzt einer „vorübergegangenen Mode“ [34] an. Anders als im romantischen Plot kommt der Held zu Hause an – und zwar gleich zu Textbeginn: Immenseehat die Geschichte des Romantikers zu Ende erzählt. Seinen Lebensabend fristet er in einem einsamen Haus am Stadtrand und es ist eingetroffen, was Hegel prophezeit hat: Reinharts sehnsüchtiges Umherschweifen hat ihn letztlich in den Solipsismus geführt. Nur ein Bild noch ist ihm von Elisabeth geblieben, allein die Erinnerung wird hin und wieder noch mit sinnspendender Romantik verbunden und tröstet über die Mängel der Gegenwart hinweg: „ein schwarzes Gewässer legte sich hinter das andere, immer tiefer und ferner, und auf dem letzten so fern, daß die Augen des Alten sie kaum erreichten, schwamm einsam zwischen breiten Blättern eine weiße Wasserlilie“ [35] – so das abschließende innere Bild des Alten, das seine stabile Verfassung sichert und den besonderen Moment noch in den erinnerten Erlebnissen der Vergangenheit bewahren kann.
Anmerkungen
[1] Storm, Theodor: Sämtliche Werke in vier Bänden. Bd.1 Gedichte / Novellen 1848–1867, hg. von Karl Ernst Laage/Dieter Lohmeier, Frankfurt am Main 1987, S. 311. (Werkausgabe nachfolgend zitiert unter der Sigle LL).
[2] LL 2, S. 304.
[3] LL 2, S. 321.
[4] LL 2, S. 323. Der Hinweis auf Novalis schon bei Eckart Pastor: Die Sprache der Erinnerung. Zu den Novellen von Theodor Storm, Bodenheim 1989, S. 68.
[5] Manfred Frank: Unendliche Annäherung. Die Anfänge der philosophischen Frühromantik, Frankfurt am Main 1997.
[6] LL 2, S. 323.
[7] Vgl. Otto Pöggeler: Hegels Romantik der Romantik, Bonn 1956.
[8] G. F. W. Hegel: Vorlesungen über die Ästhetik I, Frankfurt am Main 122013, S. 96.
[9] LL 2, S. 302.
[10] Vgl. Richard Brinkmann: Wirklichkeit und Illusion. Studien über Gehalt und Grenzen des Begriffs Realismus für die erzählende Dichtung des 19. Jahrhunderts, Tübingen 1966.
[11] LL 4, S. 393.
[12] Ludwig Feuerbach: „Grundsätze der Philosophie der Zukunft“, in: Ders.: Kleinere Schriften II (1839–1846), hg. von Werner Schuffenhauer, Berlin 1970, S. 311.
[13] Thomas Mann: Theodor Storm Essay, hg. von Karl Ernst Laage, Heide 1996, S. 18, S. 35.
[14] LL 1, S. 14f.
[15] LL 4, S. 381.
[16] Ferdinand Tönnies: Theodor Storm. Gedenkblätter, Berlin 1917, S. 34.
[17] Brief an Hartmuth Brinkmann, 22. März 1852, in: Theodor Storm – Hartmuth und Laura Brinkmann. Briefwechsel. Kritische Ausgabe, hg. von August Stahl, Berlin 1986, S. 56.
[18] Ebd.
[19] LL 4, S. 380.
[20] Vgl. Clifford Albrecht Bernd: „Theodor Storm und die Romantik“, in: Schriften der Theodor-Storm-Gesellschaft 21 (1972), S. 24–37.
[21] LL 4, S. 488.
[22] F. W. J. Schelling: „Einleitung zu dem Entwurf eines Systems der Naturphilosophie oder über den Begriff der speculativen Physik und die innere Organisation eines Systems dieser Wissenschaft (1799)“, in: Ders.: Ausgewählte Schriften. Bd.1, 1794–1800, Frankfurt am Main 1985, S. 337–394, S. 345.
[23] Vgl. Christian Demandt: Religion und Religionskritik bei Theodor Storm, Berlin 2010.
[24] So geschehen bei Tamara Silman: „Theodor Storms ‚Meeresstrand‘“, in: Schriften der Theodor-Storm-Gesellschaft 25 (1976), 48–52, die ein Umschwenken „aus der konkreten Welt in die Welt des Unheimlichen“ (S. 50), ein „Hinübergleiten ins Jenseitige“ (S. 51) konstatiert. Der Befund lässt sich mit Mark Fischers Beschreibungen zum Gespenstischen verbinden. Mark Fischer: The Weird and the Eerie, London 2016, S. 12: „The eerie concerns the most fundamental metaphysical questions one could pose, questions to do with existence and non-existence: Why is there something here when there should be nothing? Why is there nothing here when there should be something?“
[25] Sandra Kerschbaumer/Stefan Matuschek: „Romantik als Modell“, in: Daniel Fulda/Sandra Kerschbaumer/Stefan Matuschek (Hg.): Aufklärung und Romantik. Epochenschnittstellen, Paderborn 2015, S. 141–155, S. 145.
[26] LL 4, S. 332.
[27] So zumindest laut Jost Schillemeit: „‚Erlebnis‘. Beobachtungen eines Literarhistorikers zu einer Wortbildung des 19. Jahrhunderts“, in: Armin Burkhardt/Dieter Cherubim (Hg.): Sprache im Leben der Zeit. Beiträge zur Theorie, Analyse und Kritik der deutschen Sprache und Gegenwart, Tübingen 2001, S. 319–332. Dass in der Erlebnisterminologie Strukturen der Goethezeit fortwirken, legt die Theoretisierung des Erlebens durch Wilhelm Dilthey und weitere nah. Zur These einer lebenspraktischen Wende vgl. Herbert Schnädelbach: Philosophie in Deutschland 1831–1933, Frankfurt am Main 1983.
[28] Die Prominenz des Erlebnisbegriffs sorgt auch für eine kritische Thematisierung in Einführungsbänden zur Gedichtanalyse. Dieter Burdorf: Einführung in die Gedichtanalyse,Stuttgart [u.a] 21997, S. 182ff. Vgl. zu Kritik und Chancen von Gattungsspezifika Marianne Wünsch: „Erlebnislyrik“, in: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft. Bd.1, hg. von Klaus Weimar, Berlin 1997, S. 498–500. Ein bis heute eher wenig erfolgreicher Rettungsversuch des Begriffs für die Analyse von Storm-Gedichten findet sich bei Dieter Lohmeier: „Das Erlebnisgedicht bei Theodor Storm“, in: Schriften der Theodor-Storm-Gesellschaft 30 (1981), S. 9–26.
[29] Brief an Eduard Mörike, November 1854, in: Theodor Storm – Eduard Mörike / Theodor Storm – Margarete Mörike. Briefwechsel. Mit Storms „Meine Erinnerungen an Eduard Mörike“,hg. von Hildburg/Walter Kohlschmidt, Berlin 1978, 50ff.
[30] LL 1, S. 47f.
[31] Vgl. Manfred Frank: „Das „fragmentarische Universum“ der Romantik“, in: Lucien Dällenbach/Christiaan L. Hart Nibbrig (Hg.): Fragment und Totalität, Frankfurt am Main 1984, S. 212–224.
[32] Katja Stopka: Semantik des Rauschens. Über ein akustisches Phänomen in der deutschsprachigen Literatur, München 2005.
[33] Mann: Theodor Storm Essay, S. 25.
[34] LL 1, S. 295.
[35] LL 1, S. 328.