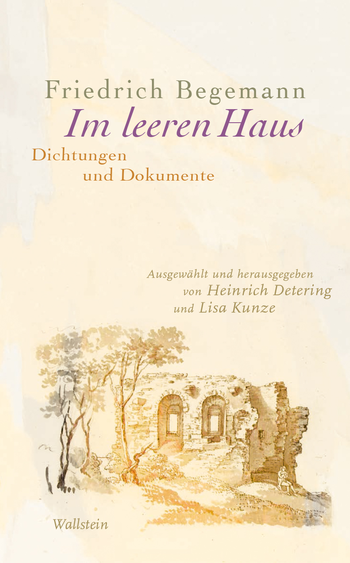Heinrich Detering, Lisa Kunze (Hgg.)
Friedrich Begemann
Im leeren Haus. Dichtungen und Dokumente
Der vorliegende Band zum Werk von Friedrich Begemann (1803-1829) unter dem Titel Im leeren Haus, herausgegeben von Heinrich Detering und Lisa Kunze, weiß bei der Lektüre auf mindestens zweifache Weise zu rühren. Dies zum einen durch den viel zu frühen Tod des Autors, der wiederholt auf den insgesamt 165 Seiten thematisiert wird. Und der ohne jeden Zweifel Auswirkungen auf Begemanns literarisches Schaffen wie auch auf seine Nachwelt gehabt hat. Begemann, geboren 1803 im Fürstentum Lippe, starb mit gerade einmal 25 Jahren ebenda an Schwindsucht. Insofern haben die Lesenden der verschiedenen abgedruckten Textgattungen von Im leeren Haus immer das Gefühl, dass hier einer viel zu früh gehen musste – und der dies wohl auch ahnte, denn „[d]as Verderben eilt“ (S. 111), wie es in einem von Begemanns Poemen heißt.
Nachklingt dabei stets die leise Frage: Was wäre gewesen, wenn ihm, Friedrich Begemann, mehr Lebenszeit gegönnt gewesen wäre? Wäre er dann auch in Vergessenheit geraten oder wäre dies bei anhaltender literarischer Produktivität schier unmöglich gewesen, weil er durchaus das Potential gehabt hätte, sich bereits in den literarischen Kanon vergangener Tage nachhaltig einzuschreiben? Einer seiner ersten Biografen, der Detmolder Richter Karl Ziegler, legt Letzteres jedenfalls nahe, wenn er schreibt: „Der geehrte Leser wird zugleich [.] erkennen, daß, wenn Begemann länger gelebt hätte, Heine vielleicht nicht von sich behauptet haben würde, daß er der letzte Fabelkönig d. h. Dichter im Reiche der Romantik gewesen [sei; D.G.]“ (S. 43).
Es ist somit ein großes Verdienst der beiden Herausgeber, Begemann wiederentdeckt und ihn zurückgeholt zu haben in jenen (häuslichen) Reigen der Romantikerinnen und Romantiker, wo er einerseits hingehört und andererseits durch die Veröffentlichung des Bandes nun für die Nachwelt deutlich sichtbar(er) geworden ist. Diese Grundintention von Detering und Kunze kann jedenfalls als geglückt angesehen werden.
Zu rühren vermag, zum anderen, aber nicht nur die Tragik in Bezug auf Begemanns unvollendetes Leben und Schaffen, sondern auch dessen – zumeist lyrische – Texte selbst, welche in ihrer Gesamtschau erstmals im Band zusammengestellt sind und denen zumeist ein schwärmerischer Grundton zu eigen ist. Als kleine Kostprobe sei eine Strophe aus dem Gedicht Sängers Heimkehr in’s Vaterland, im Herbste wiedergegeben:
„[…]
Wie mild die Sonne Dich erwärmte,
Erwärmte Liebe meine Brust;
Wie Bien’ und Vogel Dich umschwärmte,
Umschwärmten Träume mich und Lust.
Nicht schöner blüh’ten Deine Blumen,
Als meine Hoffnung, und mein Glück;
Wie Deines Himmels blaue Räume,
Schien still und heiter mein Geschick. […]“ (S. 113)
Zugegeben: Es ist ein Balanceakt beim Lesen der Verse nicht sofort zu denken, dass die Poesie eines Friedrich Begemanns durchaus kitschige Nuancen aufweist. Dieser Lektüreeindruck greift jedoch zu kurz. Denn so hat sich der romantische Dichter nicht nur um einen eigenen Stil bemüht, sondern vor allem die Lyrik seiner Zeit wie jene seiner Vorgänger aufgenommen und transformiert. Mehr noch: Begemann hat sich auch in anderen Sprachen versucht. Abgedruckt findet sich beispielweise im Band ein Gedicht unter dem Titel Stabat Mater aus dem Mönchslatein des Mittelalters (vgl. S. 86 ff.), ein Poem (Aufblick, S. 92) aus dem Spanischen und sogar eines in plattdeutscher Sprache (Des Bauern Abschied, S. 82).
Besonders prägend für Begemann dürfte allerdings die Auseinandersetzung mit dem Nibelungenlied sowie die Beschäftigung mit der Märchenwelt der Gebrüder Grimm gewesen sein. Augenfällig ist dies etwa in der im Band abgedruckten Geschichte Der kleine Riese Grimoald (S. 99). Die Geschichte folgt weniger einer klaren Handlung, sondern driftet auf wundersame Weise immer wieder ab – und lädt dadurch die Lesenden ein, wiederholt am Anfang zu beginnen. Exemplarisch dafür sei die dritte Strophe wiedergegeben:
„Da Sprach der alte Siegmar: ‚Er selbst weiß wenig nur,
Wie er einst war, und wie er dann kam auf unsre Flur.
Und der immer selten, und dann ganz kurz nur spricht,
Der spricht vor allen Dingen von seinem Schicksal gerne nicht.“ (ebd.)
Der lyrische Text lebt im besten Sinne weniger von dem, was eigentlich erzählt wird, sondern allein von seinem Rhythmus. Dieser bringt unter anderem „eine Horde Elstern“ (S. 100) im Weiteren hervor, lässt einen „Wolf“ springen (S. 101) und eine „Hindin“ [sic!] (S. 100) wie einen Schatten verschwinden. Verwundert schaut der Lesende auf und fragt sich: Was geschieht hier eigentlich?
Die teilweise verzaubernden Texte aus dem Oeuvre von Begemann stehen damit in einem gewissen Kontrast zum klar strukturierten Band. Zunächst werden Werk und Autor kurz eingeordnet (S. 9-16), dann ist eben jenes essayartige Porträt von Karl Ziegler über Begemann abgedruckt (S. 17-44), das weiter oben schon Erwähnung fand, bevor sich verschiedene lyrische Texte, zum Teil veröffentlicht, zum Teil unveröffentlicht, wiederfinden (S. 45 ff.). Es folgen des Weiteren einige Briefe von Begemann (S. 115-122) sowie persönliche Dokumente und Ausführungen von Freunden über den Autor (S. 123-150). Den Abschluss der Publikation bildet ein kurzer Anhang, dem sich ein Lebenslauf zu Friedrich Begemann entnehmen lässt sowie ein knappes Personenregister (S. 151 ff).
Aus der Kürze des Registers sollten jedoch keine voreiligen Schlüsse im Hinblick auf die Bekanntheit von Begemann gezogen werden. Vielmehr lesen sich die verschiedenen Namen, zu denen beispielsweise Friedrich de la Motte Fouqué, Jacob und Wilhelm Grimm, aber auch Ludwig Tieck gehören, wie ein handverlesener Kreis von Freunden, Unterstützern und natürlich von Zeitgenossen, mit denen Begemann in Kontakt stand. Zu letzterem Personenkreis zählt beispielsweise kein Geringerer als Johann Wolfgang von Goethe. Diesem hatte Begemann am 10. September 1828 einen Brief geschrieben, in dem er den Dichterfürsten im Grunde um ein Resonanzzeichen in Bezug auf seine Lyrik bat – oder wie es bei Begemann heißt „[…] um ein geneigtes Ohr zu meinen Klängen [..]“ (S.119). Die postalische Sendung an Goethe enthielt Begemanns einzige größere Veröffentlichung, die ihm zu Lebzeiten glückte. Es handelt sich dabei um den Gedichtband Blumen von der Saale. Episches und Lyrisches, den Begemann auf eigene Kosten während seiner Zeit in Jena publizierte.
Interessant ist nun weniger der Vorgang als solches – Begemann war mit seinem Schreiben einer unter vielen, der sich an den berühmten Geheimrat in Weimar wandte. Entscheidender ist, wie dieser Umstand im Nachgang ausgedeutet wird. Während Karl Ziegler im Begemann-Porträt behauptet, „aus sicherer Quelle“ (S. 18) gehört zu haben, dass Goethe sich „sehr lobend“ (ebd.) über Begemanns Anthologie geäußert habe, erwähnen die beiden Herausgeber von Im leeren Haus eher beiläufig (im Personenregister, vgl. S. 162), dass Goethe Begemanns Blumen von der Saale nicht einmal ‚aufgeschnitten‘ habe und auch die „weitergehende Förderung des jungen Dichters“, durch den Geheimrat „ins Reich der biografischen Legendenbildung“ (ebd.) gehören würde.
Anhand dieses kleinen Details wird ersichtlich, worin ein wenig die Schwäche von Im leeren Haus besteht: Es fehlt die (kritische) literaturwissenschaftliche Durchdringung des dargelegten Werks von Friedrich Begemann vor allem in Bezug auf dessen Umfeld. Anders ausgedrückt: Es wäre wünschenswert gewesen, wenn die Rolle der Zeitgenossen, wo immer möglich, mit ausbuchstabiert worden wäre – nicht als Randnotiz etwa im Anhang, sondern als eigenes Kapitel. Damit keine Missverständnisse entstehen: Das Werk von Friedrich Begemann wiederentdeckt und in jenem Band zusammengetragen zu haben, muss als ein – in jeglicher Hinsicht – absoluter Gewinn bezeichnet werden. Dies sowohl für an romantischer Literatur Interessierte als auch für Forschende. Trotz des Hinweises der Herausgeber, dass es sich um das „ausführlichste und schönste biografisch-werkgeschichtliche Porträt“ (S. 11) handelt, erschließt sich allerdings nicht so recht, weshalb das literarische Zieglersche Begemann-Biopic so viel Raum im Band einnimmt, wenn es doch hätte noch kritischer kommentiert werden müssen.
Aber vielleicht sollte dies weniger als Kritik verstanden werden, sondern vielmehr als Auftrag, anhand der gelungenen Grundlage zu Werk und Autor weiterzuforschen.
Rezension verfasst von Daniel Grummt