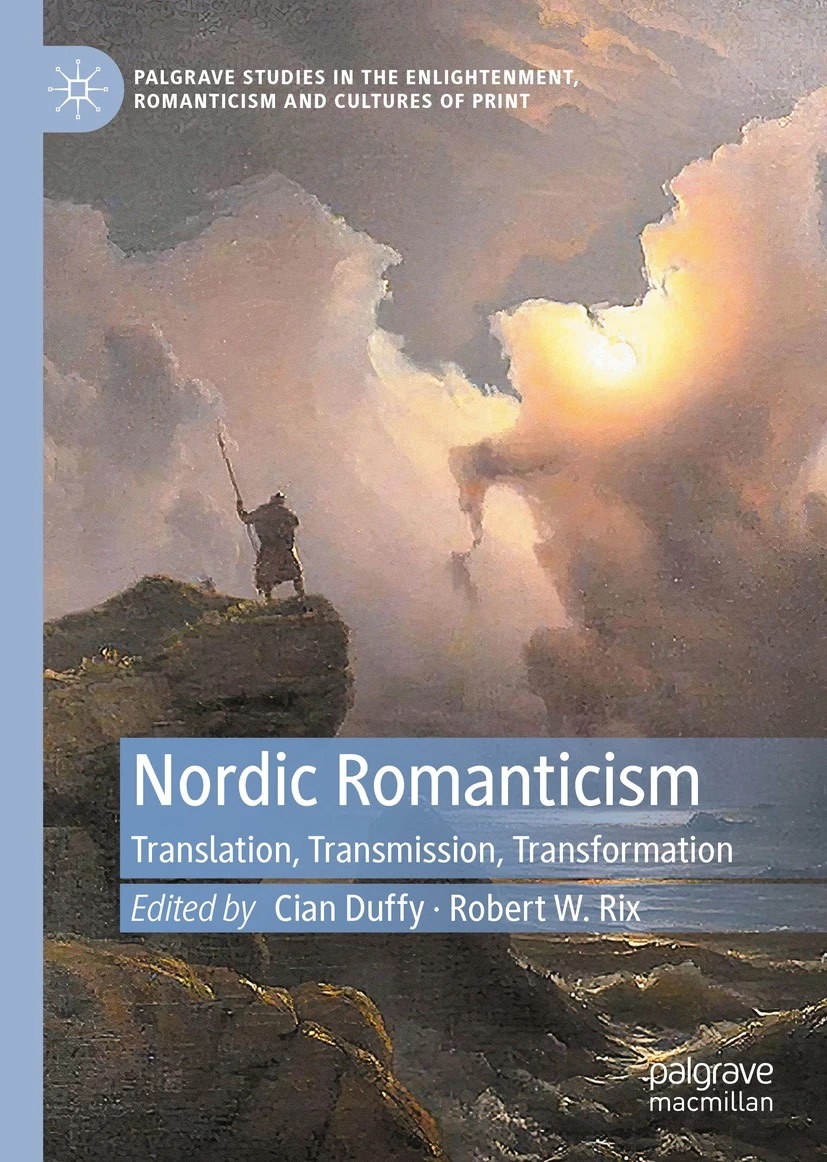Cian Duffy, Robert W. Rix (Hgg.)
Nordic Romanticism
Translation, Transmission, Transformation
Transfer, Interaktion, die Aufhebung von Grenzen, aber auch persönlicher Austausch, Reisetätigkeit und Interesse für die Erzeugnisse anderer sind den Literaturen der Romantik eingeschrieben. Das gilt, seitdem Friedrich Schlegel sein Diktum einer progressiven Universalpoesie als Sympoesie und Vereinigung von Gattungen im 116. bzw. 125. Athenäums-Fragment (1798) formulierte. Es ist daher nicht nur naheliegend, sondern auch zeitgemäß, die Romantik als ein gesamt- oder – mit spezifischerem Fokus – nordeuropäisches Phänomen zu betrachten, für das die Übertragung, Weitergabe und Modifikation von kulturellen Erzeugnissen wesenhaft ist.
2010 erschien mit Romantik im Norden (hg. von Annegret Heitmann/Hanne Roswell Laursen) ein Sammelband, der die Wechselbeziehungen deutscher und skandinavischer Romantiken in den Fokus rückte. Der vorliegende Band Nordic Romanticism: Translation, Transmission, Transformation teilt diesen Blickwinkel und erweitert ihn – nicht zuletzt in translationswissenschaftlicher Hinsicht –, indem er zentrale Erscheinungen der nordischen Romantiken als transnationales Phänomene im Sinne der Zirkulation, Übertragung und Wiederholung von Texten und Ideen versteht: „we map, here, how texts travelled across borders as material objects that can be traced in terms of concrete events and the particular people who acted to make these events happen.“ (xxvii)
Diese Sichtweise rückt die materielle Seite der Zirkulation kultureller Erzeugnisse in den Fokus. Die Verfügbarkeit von Texten sowie die Intention und Qualität von Übertragungen ist dabei von verschiedenen Bedingungen abhängig und beeinflusst den Weg, den romantische Gedanken über Länder- und Sprachgrenzen hinweg nehmen konnten oder eben nicht. So findet die Fähigkeit der dänischen Kulturelite, deutsche Texte im Original zu lesen, ihren Kontrast etwa darin, dass der berühmte englische Romantiker Percy Shelley bis zum Ende des 19. Jahrhunderts in Schweden fast gänzlich unbekannt war. Zum Band Beitragende wie Diego Saglia und Cian Duffy sind Teil einer jungen Forschungstradition, die eine veränderte Sichtweise auf Romantik als nicht nationale, sondern regionale Erscheinung propagiert (ihrerseits im Anschluss an die gar nicht so neue Forschungsdebatte, ob die europäische Romantik national oder gesamteuropäisch aufgefasst werden sollte).
Natürlich wirft der Titel die Frage auf, was überhaupt zu einer „nordischen Romantik“ zählt. Die Herausgeber verstehen darunter „the varied and complex interactions between national Romanticisms in Britain, Denmark, Germany, Norway, and Sweden in the late eighteenth and nineteenth centuries.“ (xix) Dass Großbritannien und Deutschland zum „Norden“ gerechnet werden, versteht sich im Anschluss an zeitgenössische Positionen wie jene von Germaine de Staël, die kulturelle Aspekte stärker als geographische gewichteten. So untersuchen die Beiträge insbesondere Rezeption und Einfluss der nordischen Romantiken in Großbritannien und Deutschland und umgekehrt, wobei für die deutsche Sprache eine Sonderrolle als Medium des kulturellen Austauschs angenommen wird. Dass sich zudem das gemeinsame Kulturerbe zu einem veritablen Teil aus altnordischen Mythen und Texten speist – welche erst ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in anderen Sprachen als Latein verfügbar waren –, belegen mehrere der Kapitel. Der Bezugsrahmen der Nordseeküste (xxiv) als Raum einer romantischen kulturellen Produktivität lässt allerdings die Frage offen, warum im Band Island nur in diachroner Hinsicht eine Rolle spielt, während die isländische Romantik ebenso wenig wie die niederländische, irische und finnische thematisiert werden. Romantik wiederum wird weitgehend mit Nationalromantik(en) gleichgesetzt.
Die komplexe romantische Auffassung von „Übersetzung“ wird im Einführungskapitel nachvollzogen und in sieben von zehn Beiträgen explizit thematisiert, wodurch es dem Band gelingt, auch die Bedeutung von Textübertragungen für den Kulturtransfer generell zu beleuchten. Der fluide Austausch von romantischem Gedankengut wurde, so eine zentrale These des Bandes, erst nachträglich spezifischen nationalen Diskursen zugeordnet. Leider werden die beiden anderen Titelbegriffe „Transmission“ und „Transformation“ weder im Einführungskapitel behandelt noch im Index gelistet (beide erscheinen dann auch kaum im Band). Es wäre durchaus ertragreich gewesen, auch diese etymologisch/kulturhistorisch zu reflektieren.
Trotz der Einschränkung auf Nationalromantik(en) trägt der Band indirekt Schlegels Diktum Rechnung, indem er nicht nur verschiedene Genres wie Dichtung, Drama und Malerei integriert, sondern auch mit dem Zeitraum von 1689–1892 die Grenzen über die enge Periode der historischen Romantik hinaus öffnet. Dabei präsentiert er sich nicht einfach als Sammelband, sondern als Folge von zehn nahezu chronologisch aufeinander aufbauenden Kapiteln. Am Anfang steht die Untersuchung der Adaption von Goethes Erlkönig und dessen Übersetzung ins Englische und Dänische (Robert W. Rix). Es folgt die Analyse der altnordischen Biarkamál Fragmente in Bertel Christian Sandvigs Danske Sange af det ældste Tidsrum (1779), die nicht nur in einem europäischen Kontext verortet, sondern auch in ihrer Bedeutsamkeit für die dänische Literatur der Romantik herausgestellt werden (Andreas Hjort Møller). Sodann geht es um die Multilingualität in transnationaler Literatur, die der Leitvorstellung von muttersprachlicher Einsprachigkeit entgegensteht – anhand der Werke von Friederike Brun und Jens Baggesen (Anna Sandberg). Mit Adam Oehlenschläger, dessen Gedicht Guldhornene (1802) typischerweise als exakt zu datierender Startschuss der dänischen Romantik verstanden wird, wendet sich der Band dann dezidiert der romantischen Periode zu (Cian Duffy). Der folgende Beitrag legt die Rolle und das Verständnis von Nordeuropa in der britischen Literatur der 1820er dar (Diego Saglia). Der sechste und siebte Beitrag befassen sich mit der Malerei: Lone Kølle Martinsen und Gertrud Oelsner verfolgen die Idee eines spezifischen nordischen „Sonderwegs“ in die Moderne und damit auch die Frage, wie komplexes Gedankengut auf die Leinwand überführt werden kann; Thor J. Mednick untersucht dänische Landschaftsmalerei des 19. Jahrhunderts als Ausdruck von Lebenserfahrungen, erwachender Modernität und der Interaktion bildschaffender Künstler*innen mit ihrem politischen, soziologischen und kulturellen Milieu. Das achte Kapitel (Hannah Persson) rückt mit Mary Howitts Übersetzungen von Hans Christian Andersens Märchen – und den Gründen für die Freiheiten, die sie sich dabei erlaubte – erneut ein dänisches Thema in den Fokus, während die beiden letzten Kapitel sich schwedischen Themen zuwenden: zum einen der Rezeption der britischen sozialpolitischen Ökonomin und Schriftstellerin Harriet Martineau in Schweden, die dort in den 1830er Jahren an Popularität gewann (Cecilia Wadsö Lecaros), zum anderen Hellen Lindgrens Essay (1892) über den englischen Romantiker Percy Bysshe Shelley, der überraschenderweise bis dahin in Schweden vollkommen unbekannt war (Carl-Ludwig Connin).
Es wird deutlich, dass der Schwerpunkt auf dänischem Kunstschaffen liegt, was auch aufgrund von Dänemarks kultureller Vormachtstellung im fraglichen Zeitraum durchaus von den Herausgebern intendiert ist. Dass allerdings Norwegen im ganzen Band kaum Erwähnung findet – und wenn, dann in Bezug auf politische Verhältnisse – und so etwa die wichtigsten norwegischen Romantiker Henrik Wergeland und Johan Sebastian Welhaven nirgendwo genannt werden, wird doch dem Anspruch des Bandes nicht ganz gerecht.
Exzellent ist die Qualität der Beiträge. Sie analysieren romantischen Kulturaustausch in vielfacher reziproker Verzahnung und öffnen zudem eine Perspektive auch auf den gegenwärtigen Blick auf transnationales Kulturschaffen. Dies sei an zwei Beiträgen exemplarisch illustriert.
So zeigt Anna Lena Sandberg auf, dass das (politische) Postulat einer nationalen linguistischen Einheit – der Muttersprache – um das Jahr 1800 die tatsächlich gegebene Multilingualiät und Multikulturalität der Nordseestaaten verschleiert. Ebenso steht auch die Vorstellung von monolingualen Nationalliteraturen der literarischen Praxis der Zeit entgegen. Dänemark war am Übergang zum 19. Jahrhundert ein multinationaler Staat vom Nordkap bis nach Altona mit Territorien im Atlantik und Kolonien in West Indien und Afrika. In einer Zeit jedoch, in der der kosmopolitische Blick einem nationalen Fokus weicht, ist die Rezeption bilingualer Autor*innen wie Jens Baggesen (1764–1826) und Friederike Brun (1765–1835) stark von Ort und Sprache der Veröffentlichung abhängig. Obwohl die Bedeutung der deutschen Sprache in Dänemark immens war, führte die nationalsprachliche Idee so zur Marginalisierung von Bruns in Kopenhagen auf Deutsch publiziertem Werk, während Baggesens deutschsprachige Werke vor dem Hintergrund der Überzeugung, dass nur muttersprachliche Werke dem Genie Ausdruck verleihen könnten, im Gegensatz zu seinen dänischsprachigen kaum Beachtung fanden. Indem Sandberg nachzeichnet, wie in der Folge postkolonialer Theorie in den letzten Jahrzehnten Autor*innen gerade als Grenzgänger im Begegnungsraum verschiedener Kulturen gelesen werden, diskutiert die Verfasserin des Aufsatzes zuletzt Forschungsansätze, bilinguale und multinationale Verfasserschaften wie diese nicht mehr unter dem Etikett der „Europäischen“ oder „Weltliteratur“ zu fassen, sondern den besonderen Gegebenheiten von Grenz-Verfasserschaften Rechnung zu tragen.
Hannah Perssons Beitrag über Mary Howitts Erstübersetzung von Andersens Märchen ins Englische im Jahr 1845 belegt plastisch, wie sich die Zirkulation von Kulturgütern als abhängig von personellen und materiellen Gegebenheiten zeigt. Die Übersetzung kann nicht als geglückt gelten – nicht nur der Stil, auch die Moral verschiedener Märchen wurde verändert. Persson führt dies auf abweichende kulturelle und soziale Normen in beiden Ländern zurück und legt dar, inwiefern unter anderem Howitts Wunsch, den wachsenden Markt der seriösen Kinderliteratur zu bedienen, und ihr Einblick in dessen Genrekonventionen ihre Übersetzungsarbeit modellierte. Zu Andersens Missfallen führte dies dazu, dass er in der englischsprachigen Welt exklusiv als Kinderbuchautor rezipiert wurde.
Es ist ein großes Verdienst der Anthologie, die vielfältigen reziproken Verbindungen der Romantiken in Skandinavien, Deutschland und Großbritannien als Ergebnis des wechselseitigen Transfers von Kulturgütern darzustellen und dabei über häufig als in sich geschlossen betrachtete Kulturräume hinauszudenken. Skandinavische Romantik lässt sich nur im Licht ihrer zahlreichen Übergänge verstehen – ihrer Transformationen: zwischen vorhergehenden und nachfolgenden literaturhistorischen, philosophischen, poetologischen und soziologischen Tendenzen, zwischen Übersetzung und Nicht-Unübersetzbarkeit von Kulturerzeugnissen, zwischen Genres, Gattungen und nationalen Abgrenzungen. Dass Romantik im Band nur als National-, nicht auch Universalromantik gedacht wird und (Natur-)Philosophie und Ästhetik der Romantik nur gestreift werden, nimmt ihm die Möglichkeit einer auch im engeren Sinne ästhetisch orientierten Interferenz mit poetologischen Positionen des Übergangs und der Grenzüberschreitung in der Romantik. Nichtsdestotrotz bieten nicht nur die hochwertigen, sondern auch durch ihre Kontextualisierung im Band sinnvoll vernetzten Beiträge einen hervorragenden Beitrag zur Romantik-Forschung – und zeigen nicht zuletzt, wie fruchtbar noch immer neue Forschungsperspektiven an diesen Zeitraum herangetragen werden können.
Rezension verfasst von Henrike Fürstenberg
Die Rezension ist unter dem nachfolgenden Link dauerhaft abrufbar: https://doi.org/10.22032/dbt.61379