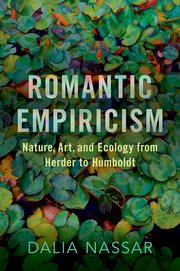Dalia Nassar
Romantic Empiricism
Nature, Art, and Ecology from Herder to Humboldt
Nicht nur das Revival des Nature Writing seit den 2010er Jahren, auch die damit eng verbundene Einsicht, dass empirische Daten kaum jemanden davon überzeugen werden, die eigene Lebensweise so zu verändern, dass der drohende ökologische Kollaps abgewendet werden kann, hat in den letzten Jahren einen regelrechten Markt für diskursüberschreitende Reflexionen der Beziehung von Kunst und Wissenschaft geschaffen.
Während sich Nature Writing über den anglophonen Raum hinaus etablierte, sind auch im Genre des „popular science writing“ Schreibweisen en vogue, die von einem erzählenden Ich aus, also nicht nur mit starken autobiographischen Anteilen, sondern auch in subjektivierter Ausdrucksweise, Fakten über ökologische Beziehungen, klimatische Systemzusammenhänge und die Folgen von Biodiversitätsverlusten als relevantes Wissen präsentieren. Im literarischen Nature Writing im engeren Sinne lässt sich dagegen immer mehr beobachten, wie stark wissenschaftliche Perspektiven auch poetische Diskurse bestimmen und wie weit der aus diesen abgeleitete Wirklichkeitsanspruch reicht. Während die einen also subjektivieren, um Wissen ansprechender zu gestalten, so ließe sich zuspitzen, versuchen die anderen, ihren Fiktionen Glaubwürdigkeit zu verleihen, um relevanter für die Gegenwart zu werden.
Doch gerade aus der Literatur im engeren Sinne mehren sich Stimmen, die die Verhältnisse umkehren und das Problem nicht in der Darstellung von Wirklichkeit, sondern in ihrer Wahrnehmung und ihrem Verstehen lokalisieren. In Deutschland forderte die Dichterin Marion Poschmann in ihrem Essay Laubwerk (2021) prägnant eine neue Romantisierung der Welt. Damit erzeugt sie nicht nur Resonanz mit dem anglophonen Nature Writing, sondern vor allem auch mit der literatur- und kulturwissenschaftlichen Ökologieforschung, die schon seit langem den Blick auf (proto-)ökologische Formen der Welterfahrung richtet, die nicht nur genuin romantische Poetiken (re-)aktivieren, sondern wie etwa Kate Rigby in Reclaiming Romanticism. Towards an Ecopoetics of Decolonization (2021) auch die politische Wirksamkeit solcher Positionen betonen.
Vor diesem Hintergrund lese ich die Studie, die Dalia Nassar unter dem Titel Romantic Empiricism bereits 2022 vorgelegt hat. In sieben Kapiteln folgt die Philosophin der Frage nach der, wie sie zeigen will, nur vermeintlich oppositionalen Beziehung von Romantik und Empirismus. Sie will zeigen, dass sich zwischen Herder, Goethe und Humboldt ein ökologisches Wissen avant la lettre und, das ist entscheidend, eine ökologische Weise der Verbindung von Kunst und Wissenschaft entwickelt, die zur „Inspiration“ (vgl. S. 247) für die Gegenwart wird.
Nassar steigt über Kants Kritik der Urteilskraft ein, um deutlich zu machen, vor welchem Hintergrund der Eindruck entsteht, dass Romantik und Empirismus im diametralen Gegensatz zueinander stehen: „It might seem peculiar to begin a book about an understudied philosophical tradition, distinguished as romantic and empiricist, with Kant. Kant is by no means understudied, and his thought is rarely regarded as either empiricist or romantic” (S. 13). Vielmehr habe Kant, so Nassar, eine Haltung gegenüber Natur etabliert, die sich strikt entlang der „gesetzgebenden“ Kraft des Verstehens bewege. Das ist nicht nur wichtig, um nachvollziehen zu können, warum der Kontrast so stark erscheint, sondern auch, weil sich alle Denker, die im Folgenden untersucht werden, direkt mit Kants Philosophie auseinandergesetzt haben.
Zentral für Nassar ist Kants bereits an dieser Stelle eingeführte Kritik an Herders Einsatz der Analogie als Erkenntnismittel. Diese Methode erscheint im Gegensatz zur rigorosen rationalen Erschließung der Naturgesetze als geradezu willkürlich, dabei, so Nassar, lässt sich hier bereits erkennen, dass ein Missverständnis (oder eine Fehlektüre) vorliege, die aber vermutlich keine signifikante Auswirkung auf Kants Ablehnung von Herders Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit gehabt hätte.
Im anschließenden Kapitel „The Hermeneutics of Nature. Herder on Animal and Human Worlds” greift Nassar Kants Gegenüberstellung von teleologischem und mechanistischem Ansatz und deren Unvereinbarkeit auf, um überleitend die Besonderheit von Herders Ansatz aufzuzeigen. Wenn man nur eines aus der Kritik der Urteilskraft mitnehme, so die Autorin, dann dass es auf die Perspektive ankäme. Sehen sei eben nicht neutral, aber daraus ergebe sich keinesfalls eine Notwendigkeit zur erzwungenen Synthese verschiedener Perspektiven:
“Rather, it implies that different approaches, invoking different methodologies, are apt for different levels of inquiry, and the real question is not how to overcome the opposition between them, but rather, how to work with both approaches in a coherent way. In other words, the crucial question is an interpretive one: given the various modes of inquiry, it is necessary to consider which mode is apt in a given context” (S.53).
Aus dieser beweglichen Sichtweise ergibt sich für Herder, so Nassar, ein Verständnis des Denkens selbst als analogische Struktur, so dass Herder aus der Verbindung dieser Struktur und der flexiblen Betrachtungsweise ein dynamisches Konzept von Natur ableite. Dieses Konzept entgehe nun den Problemen der Unvereinbarkeit von teleologischer und mechanistischer Erklärung, die Nassar bei Kant feststellt, indem Herder das Konzept nicht an den Anfang, sondern an das Ende des Verstehensprozesses setze. Hier, auch wenn das an dieser Stelle noch nicht ganz explizit wird, kommen romantische – an Ganzheit interessierte – und empirische – am Phänomen bleibende - Perspektiven zusammen und münden in einem Verständnis von Form bzw. „Hauptform“ (S. 86, S.91), dass das naturkundliche Interesse an eine ästhetische Sichtweise binde.
Wenig überraschend kommt an dieser Stelle Goethe ins Spiel. Nassar führt Goethe über die Italienische Reise als einen Naturgelehrten ein, der gleichzeitig lernt, ästhetisch und botanisch zu sehen. Beides geschieht in der Darstellung dieses Textes während seiner Reise nach Italien bzw. deren literarisch-autobiographischer Bearbeitung in der Italienischen Reise. Goethe werde schon kurz nach der Überquerung der Alpen schlagartig klar, dass die Pflanzen, die er sonst aus Gewächshäusern kennt, ursprünglich in einem Kontext von Höhenlage und Klima stehen, die ihre Form maßgeblich mitbestimmen (vgl. S. 109). Gleiches gelte für seine Erfahrung von Kunst, denn bereits als Kopien bekannte Statuen in ihrem eigentlichen Kontext zu sehen, erlaube ihm erst, sie als verbundene Form zu begreifen:
„In the same way that seeing natural objects in different contexts led Goethe to ask different questions—and arrive at deeper insights—so seeing artistic objects in a different context enabled him to arrive at deeper insights into visual art. For seeing previously “known” objects together (rather than apart) means seeing how the one anticipates or precedes the other, how it departs from but also maintains aspects of the other, and how these aspects are transformed through a new medium, a new context, a new goal.“ (S. 111).
Weder aus Herders dynamischer Perspektive noch aus Goethes Verbindung von Naturbeobachtung und ästhetischem Sehen leite sich jedoch eine beliebige interpretative und darstellerische Praxis ab, sondern vielmehr der Maßstab der „naturgemäßen Darstellung“ (S. 116). Mit Blick auf Goethes Schriften zur Metamorphose der Pflanzen leitet Nassar überzeugend eine Poetik der romantischen Empirie ab, die mit ähnlichen Herausforderungen und Potenzialen zu kämpfen hat, wie gegenwärtige Formen des Schreibens über mehr-als-menschliche Natur.
Naturgemäße Darstellung, so zeigt Nassar, betrifft nämlich die Frage, wie ein Schreiben aussehen kann, dass sich gleichzeitig für das Allgemeine und das Partikulare, das Ganze und das Teil interessieren kann, und so ästhetische Intuition am Phänomen und an der Wirklichkeit erproben kann. Diese Poetik – Nassar spricht eher von einer Ästhetik – ist es auch, die sie an Alexander von Humboldt interessiert. Die abschließenden Kapitel beschäftigen sich mit Humboldts proto-ökologischen Darstellungen der Beziehung von Organismus und Umwelt sowie seiner naturkundlichen Poetik dessen, was Nassar „embodied cognition“ (S. 212ff.) nennt. Humboldt, so Nassar, bringe nämlich nicht nur ästhetisches (durch Landschaftsmalerei geschultes) Interesse am Ganzen und ökologisches Beziehungswissen zusammen, sondern entwickle dafür eine Sprache, die das Potenzial habe, auch nichtkünstlerisch oder wissenschaftlich tätige Menschen zu inspirieren und in einen dynamischen Austausch mit mehr-als-menschlicher Natur zu bringen. Dass Humboldt diese Sicht- und Schreibweisen vor dem Hintergrund einer sich bereits ausdifferenzierten Wissenschaftslandschaft entwickelt und damit großen Erfolg beim Publikum hatte, sieht Nassar als weiteren Hinweis auf die Produktivität und Relevanz dieses Ansatzes für die Gegenwart (S. 247).
Auch wenn die Behauptung, es handle sich bei Herder, Goethe und Alexander v. Humboldt bzw. der methodischen Kontinuität ihrer Verbindung von ästhetisch-romantischen und empirisch-naturkundlichen Denkweisen um eine „understudied philosophical tradition“ (S. 13, S. 245) im Lichte einer Fülle von Studien zugespitzt erscheint, stellt Dalia Nassar den Zusammenhang so fokussiert und lesbar dar, dass diese Studie einen wichtigen Beitrag zur Frage nach dem Verhältnis von Wissen(schaft) und Kunst, insbesondere des literarischen Schreibens leistet. Zwar wäre wünschenswert gewesen, hier den Blick zumindest andeutungsweise auf die Jenaer Romantik und insbesondere auf Novalis zu richten, für den Remigius Bunia in seiner Studie Romantischer Rationalismus. Zu Wissenschaft, Politik und Religion bei Novalis (2013) ganz ähnliche Fragen behandelt hat. Denkbar wäre es auch, deutlicher auf den Zusammenhang zwischen ökologischen Schreibformen, epistemologischen Fragen und Politik einzugehen, wie er aktuell vor allem im Kontext anthropologischer Forschung (z.B. bei Anna Tsing, Eduardo Kohn und Philippe Descola) debattiert wird. Dass sich diese Anschlüsse sofort aufdrängen, ist ein sicheres Zeichen für das Potenzial dieser Studie, insbesondere für Forscher*innen der literatur- und kulturwissenschaftlichen Ökologieforschung, die nicht durch ein Germanistikstudium gegangen sind.
Rezension verfasst von Solveig Nitzke