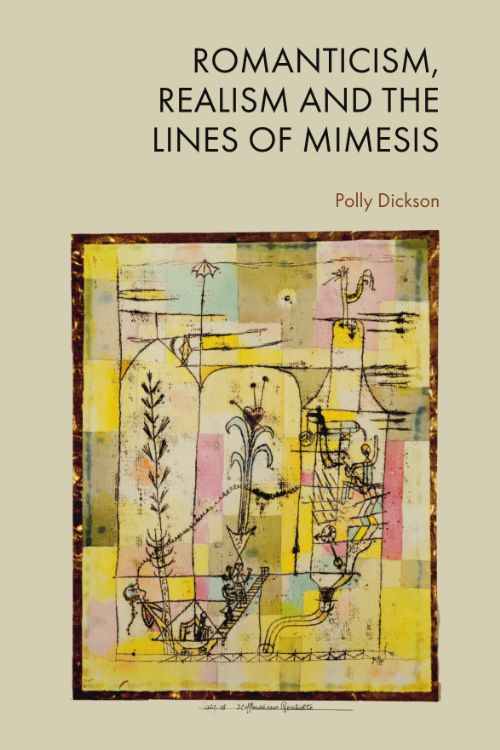Polly Dickson
Romanticism, Realism and the Lines of Mimesis
Edinburgh University Press 2024
Die Studie verfolgt die ‚lines of mimesis‘ im Sinne poststrukturaler Intertextualitätstheorien vom Werk E.T.A. Hoffmanns zu Honoré de Balzac. Aus der Linie als Wissenschaftsmetapher (sozusagen der Diskursspur) werden dabei Figurationen des Linearen und verbundener Linien im Sinne von Erzählstrukturen. So nimmt Dickson nach der Differenzierung des Mimesis-Begriffs in drei Großkapiteln die Arabeske, das Gekritzel („Scribble“) und das Kreuz als Textlogik in den Blick und zeigt jeweils an Komplementärstudien von Texten der beiden genannten Autoren sowohl jeweils neue Lesarten als auch Balzacs ambivalent-konstruktives Verhältnis zu Hoffmanns romantischem Schreiben als Prätext (durchaus im Doppelsinn des englischen Begriffs ‚pretext‘ zugleich als ‚Vorwand‘ oder ‚Deckmantel‘). Der Bezug zu Hoffmanns Romantik als „a dynamic and self-questioning one“ (21) lässt dessen Erzählungen wie „shifting intertextual coordinate[s]“ (16) erscheinen, und zwar dann, wenn es um das Verhältnis von Kunst, Natur und „imaginary capcities“ (17) geht.
Angelpunkt ist dabei stets das Konzept einer Mimesis, die nicht bei den Qualitäten des ästhetischen Artefakts ansetzt (nämlich Ähnlichkeit), sondern als epistemische Attitude zu verstehen ist, die zugleich Künstlersubjekt und Rezeptionsseite einschließt. Mimesis wird damit zum Prozess einer Anverwandlung, einem „embodied impulse to become like“ (24), der nicht hauptsächlich im Objekt erkennbar ist, sondern in dessen konstruktiver Aneignung durch das Subjekt. Im Rückgriff auf Merleau-Pontys Konzept des Chiasmus ergibt sich ein „reciprocal subject-object intertwinement“ (24). Damit legt Dickson äußerst überzeugend eine ursprüngliche, weitreichendere Bedeutung von Mimesis frei, die unter der „regrettable standard translation“ (32) der imitatio verdeckt wird, nämlich den bereits im Wortstamm ersichtlichen „impulse to mime, to become like“ (32).
Dies eröffnet der Romantik ein begriffliches Feld, das ihr in der Forschung üblicherweise verschlossen bleibt, indem die Mimesis der romantischen imaginatio entgegengestellt wird. Wenn über Schlegels Moritz-Lektüre die Natur (und deren ‚Nachahmung‘) als Weichenstellung dieses Missverständnisses angesprochen wird, verwundert allerdings die Kürze dieses Seitenblicks (an argumentativ entscheidender Stelle, immerhin dem gedanklichen Schwerpunkt der Studie). Die Pointe wird hier mehr angedeutet als dass sie aus dem zeitgenössischen Denksystem heraus fundiert wird: Die Natur nachzuahmen soll als aus der Natur heraus konstruktives Neuschaffen verstanden werden. Mimesis ist damit nicht mehr (nur) die Abformung mit dem Ziel der Ähnlichkeit, sondern eine konstruktiv-produktive Anwendung der zugrundeliegenden Prinzipien, um Originäres zu schaffen. Hier liegt nicht nur der (ebenfalls nicht behandelte) Begriff der aemulatio nahe, sondern vor allem die Kunstphilosophie Schellings, die auf seine Naturphilosophie gründet und genau diesen Gedanken ausbuchstabiert: Der Mensch als eine Art Projektion der Natur und des Absoluten kann allein in der Kunst (als gemimter Natur) dieses Absolute unmittelbar erfahren. Mimesis als Strategie des ‚to mime‘ zu verstehen, kommt vermutlich nicht ohne diesen Hintergrund aus, der bei Dickson allerdings nicht zur Sprache kommt. – Dass ein romantisches Mimesis-Konzept möglich und stimmig ist, wenn man darunter „imitation of natural creativity, rather than of natural products“ (42) versteht, überzeugt vollkommen. Der deutsche Idealismus als Grundlage dieses Gedanken gerät hier allerdings aus dem Blick.
Die Frage nach der Stellung und begrifflichen Füllung von Mimesis in Texten und kulturellen Formationen wird damit auch zur phänomenologischen Lesart, wie Dickson insbesondere mit Walter Benjamin herausstellt. Mimesis als „an attempt to understand and to account for the felt experience of a non-instrumental encounter with the world and the creation of meaning through that encounter, in wich the creative self is necessarily also felt as being part of the world” (55) zielt so auch immer auf die Beobachtung der eigenen Wahrnehmungslogik ab sowie auf die epistemische und mediale Gemachtheit von Wirklichkeit.
Auf der Basis dieser Überlegungen zur Mimesis wendet sich die Studie in der Folge den drei genannten Formen (Arabeske, ‚Scribble‘ und Chiasmus) als textueller Logik zu, indem jeweils zwei Texte der beiden Autoren gegenübergestellt werden.
Am Beispiel von Hoffmanns Goldnem Topf und Balzacs Le Peau de Chagrin stellt Dickson die Arabeske als formästhetische Essenz der (im romantisch positiven Sinne) ‚chaotischen‘ Linie vor. Als klassische Randarbeit steht diese mit ihrer nicht regelhaften und nicht semiotischen Sinnfreiheit im Spannungsverhältnis zu Ansprüchen der Nachahmung. Die zugleich zu Beginn des 19. Jahrhunderts programmatisch kritisierte, im ästhetischen Inventar aber intermedial beliebte Arabeske repräsentiert in den beiden Märchen eine Sphäre des „illegible Other“ (87), vor dem die spezifisch westliche Vorstellung von Realismus konturiert. Der Aufweis arabesker Strukturen auf der narrativen Ebene romantischen Erzählens ist dabei kein neuer Gedanke. Entscheidend ist für Dickson vielmehr, Hoffmanns Text als Ekphrasis dieser dezidiert östlichen Form zu beschreiben, wodurch sich der Text aus der (westlichen) Pflicht löst, auf einen abschließenden Sinn verpflichtet zu werden. Die Arabeske wird damit zu Textstrategie, westliche ästhetische Konventionen von Mimesis sichtbar zu machen und produktiv zu überwinden. Im Goldnen Topf figurieren insbesondere Liese und Veronika als Agentinnen alternativer weiblicher Wissensformen, denen gegenüber dem Erzähler die Probleme seines eigenen Mimesisanspruchs klar werden. So liest Dickson Hoffmanns ‚Märchen aus der neuen Zeit‘ als Text, der über sich selbst meditiert (vgl. 101) und Leserin und Leser ebenfalls in den Modus der Meditation versetzt. Balzacs Märchen wiederum greift das Hoffmanneske zwar motivisch und strukturell auf (eben in der arabesken Verbindung realistischer und phantastischer Sujetelemente); Balzac selbst allerdings distanziert sich von möglichen Verbindungslinien und tritt gerade mit diesem Gestus in ein Spiel von Setzung und Aufhebung ein.
Das Märchen über die mit jedem Wunsch schrumpfende Haut thematisiert das körperliche Relais, das sich zwischen dem Subjekt und der Außenwelt aufspannt. Beide Texte nutzen das Linienkonglomerat der Arabeske als Symbol für narrative Energie, Unbestimmbarkeit und Wiederholung und erzählen vom Selbst als narrativer, sich selbst beobachtender Instanz. Im Goldnen Topf führt dies in endlose fragmentarische Iteration; bei Balzac wird das Selbst mit dem Ende des Textes bis zum Verschwinden dezimiert. In beiden Fällen aber verliert sich das (männliche) Subjekt im Lesen und im Erzählen selbst, es gerät zum Objekt seiner eigenen Geschichte als poetologischer Reflexion über Embodiment und Verstehen. Phantastische Accessoires wie die Zauberhaut erscheinen dabei als Medien dieser Versuche, sich eine Außenwelt stabil anzuverwandeln.
Der Linienform der Arabeske folgt das ‚Scribble‘ (Gekritzel) als Vergleichsparadigma von Hoffmanns Artushof und Balzacs Le Chef-d'œuvre inconnu. Beide Texte erzählen künstlerisches Scheitern im Angesicht eines mimetischen Ideals, das sich entzieht. Während sich dieser Entzug in der Arabeske über mündliche Spiegelung und semantische Leerformen ausdrückt, wird mit dem skizzierenden, unvollendeten oder misslungenen Zeichnen eine weitere Form der Linie poetologisch aufgeladen. In beiden Erzählungen stehen Kunst und Körper, epistemisches, kreatives und erotisches Begehren sowie die Skepsis einer Mimesis gegenüber, die sich ausgerechnet im Fragmentarischen und im Unvollkommenen der Skizze abbildet. Im Artushof artikuliert sich die Kunsterfahrung als Verlust des Ideals. Bei seiner Suche nach dem vollkommenen Bild (einmal mehr verkörpert durch eine Frauenfigur – Felizitas) trifft der Protagonist Traugott stets auf Schwundstufen und Kopien des Begehrten. Felizitas bleibt als Ideal nicht fassbar, sie entzieht sich durch Verschiebung und Verdopplung (beispielsweise als Figur der Dorina), die als wiederkehrende, lediglich annähernde Abbilder die Erfahrung des Originals auf Abstand halten. Diese Frustration selbst wird dabei zur Erzählstruktur. Die Kunst bietet prinzipiell keine unmittelbare Erfüllung mehr, sondern stellt eine Form des Scheiterns und der Distanz zum Ideal dar. Die Leerstelle, die der Maler mit seinem gescheiterten Bild lässt, füllt der Text mit seinem Erzählen als Ekphrasis. Zuletzt erweist sich Felizitas als bürgerliche Frau, verheiratet mit Kindern, womit das Ideal im Alltäglichen verflacht. Die scheinbare Auflösung ironisiert den künstlerischen Anspruch, dessen Streben an der Realität scheitert.
Balzacs Le Chef-d'œuvre inconnu wird über einen Zeitraum von sechzehn Jahren in sechs Versionen publiziert und transponiert damit das Feststecken im Entwurf (‚Scribble‘) auf die Ebene der eigenen Materialität. Im Gegensatz zum Artushof verzichtet der Text auf phantastische Elemente und verlagert die schon bei Hoffmann verhandelte Frage nach der Darstellbarkeit des Ideals in den Blick der Hauptfigur. Der Maler Frenhofer will die Wirklichkeit bildlich reproduzieren, ohne auf bekannte Darstellungskonventionen zurückzugreifen, die den Blick von Künstler und Betrachter stets vorformatieren. Anstelle der Linie sollen vielmehr Farbe und Fläche treten.
Das letzte Textpaar bilden Hoffmanns Elixiere des Teufels und Balzacs L'Élixir de longue vie. Letzteres ist dabei ausgerechnet dadurch interessant, dass es als einziger von Balzacs Texten ein explizites Bekenntnis des Autors enthält, sich auf einen Hoffmann’schen Prätext (die Elixiere) zu beziehen, obwohl die Forschung herausgestellt hat, dass dem gerade in diesem Fall nicht so ist. – Diese paradoxe intertextuelle Verschränkung dient Dickson als Stichwort für die dritte und abschließende Konstellation von Linien: dem Chiasmus. Diesen liest Dickson im Sinne von Merleau-Ponty als Figuration der Wahrnehmung, als verschränkten Vorgang, in dem das sehende Subjekt selbst gleichfalls als sichtbares Objekt erfahren wird. Kunst und Mimesis erscheinen vor diesem Hintergrund als Reflexion auf die Wahrnehmung selbst. Das Kreuzmal, mit dem Medardus gezeichnet ist, verweist unmittelbar auf diesen Chiasmus, wiederholt sich allerdings am Doppelgänger des Protagonisten. Damit wird es in der Diegese als Identifikationsmerkmal unbrauchbar und zugleich als Textverfahren dekonstruiert. Dickson liest Hoffmanns Roman in der Folge als Erzählung von gescheiterter Identität. Das (Wieder-)Erkennen von Figuren misslingt im Angesicht ihrer Reproduzierbarkeit. Und letztlich wird Medardus zur Figur seiner eigenen Geschichte. Die Schreibszene, die den Rahmen des Romans bildet, überführt den Körper des Mönchs in Text.
Balzacs L’Élixir, über seine falsche Fährte an Hoffmanns Elixiere gebunden, knüpft an diesen wiederum nicht im Plot an, sondern im ästhetischen Prinzip des Schauerromans sowie der darin eingebetteten Frage nach devianter familiärer Fortsetzung, Figurendopplung (anstelle echter Fortpflanzung) und einem Vater als unsterblichem Monster. – Der Sohn wiederum tötet nicht nur den Vater, sondern versucht ihn zugleich zu imitieren, gerät dabei allerdings selbst zum monströsen Fragment. In diesem motivischen Bruch mit heteronormativer Genealogie tritt auch die zu Beginn angekündigte Ebene einer queeren Lesart hervor, die insgesamt aber eher selten angesprochen wird.
Eine der abschließenden Beobachtungen Dicksons hält fest, der Realismus gewinne seine Identität durch die Auseinandersetzung mit der Romantik. Dem ist vor dem Hintergrund der diesbezüglich noch immer überschaubaren Forschungslage mit Nachdruck zuzustimmen und für diesen Punkt erarbeitet die Studie wertvolle Beobachtungen in den jeweiligen Lektüren. – Der Anspruch aber, etwas über Romantik und Realismus ‚an sich‘ zu sagen, steht vor verschiedenen Schwierigkeiten. Zum einen verlangt die Studie einer nicht im postmodernen Theoriespektrum bewanderten Rezeption (beispielsweise kultursemiotisch, imagologisch oder diskursanalytisch arbeitenden Leserinnen und Lesern) einige Eigeninitiative ab, was dem methodischen Zuschnitt der Arbeit sowie der Deutungsoffenheit poststrukturaler Begrifflichkeit geschuldet ist, die zudem zugleich eine Durchlässigkeit von Text und Welt (auf argumentativer Ebene) anbringt.
Zum anderen vermag Hoffmann kaum ‚die Romantik‘ zu repräsentieren, wie auch immer man das Literatursystem fassen möchte. Das scheint Dickson zwar bewusst, wenn Sie betont, Balzac als Begründer des französischen Realismus zu betrachten, während Hoffmann als Repräsentant einer „particular Gothic strain of late german Romanticism“ (4) gilt. Dass er zugleich (später auch sinnvoll aus der bestehenden Forschung belegt) als „proto-realist“ (4) erfasst wird, steht – um im Bild der Studie selbst zu bleiben – chiastisch zum ebenfalls angemeldeten Anspruch, Hoffmann und Balzac als „paradigmatic of two literary modes“ (1) zu sehen. Der ‚Mode‘ wiederum scheint sich von Denkern wie Jakobson und Barthes herzuschreiben und rekurriert letztlich auf eine Schreibweise als überzeitliche Signatur, das Romantische und das Realistische. Was damit gemeint ist und warum offenbar bewusst nicht auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede von als solchen durchaus differenzierbaren Literatursystemen europäischer, deutscher, französischer Romantik respektive ebensolcher Realismen eingegangen wird, wäre zumindest kurz zu begründen gewesen.
Dass über Hoffmanns Berklinger auch Wackenroders Berglinger (und damit die deutschsprachige Frühromantik) aufgerufen wird, gerät ebenso aus dem Blick wie Hoffmanns letzter zu Lebzeiten publizierter Text Des Vetters Eckfenster, der für das hier Verhandelte eigentlich paradigmatisch und zudem in der Zeitschrift Der Zuschauer (das Pendant zum bezüglich Balzacs L’Élixir erwähnten Spectator; vgl. 175) erscheint und damit auch den Faden des zu Beginn angebrachten material turn (vgl. 2) aufgegriffen hätte.
Bezüglich europäischer oder deutscher Romantik respektive Realismus dürften die Ergebnisse der Studie eher Aperçu-Charakter haben. – In Bezug auf die intertextuelle Beziehung zwischen E.T.A. Hoffmann und Honore de Balzac hingegen sind die Lines of Mimesis eine kenntnisreiche und inspirierende Gesamtschau.
Rezension verfasst von Stefan Tetzlaff.
Die Rezension ist unter dem nachfolgenden Link dauerhaft abrufbar:
https://doi.org/10.22032/dbt.67087