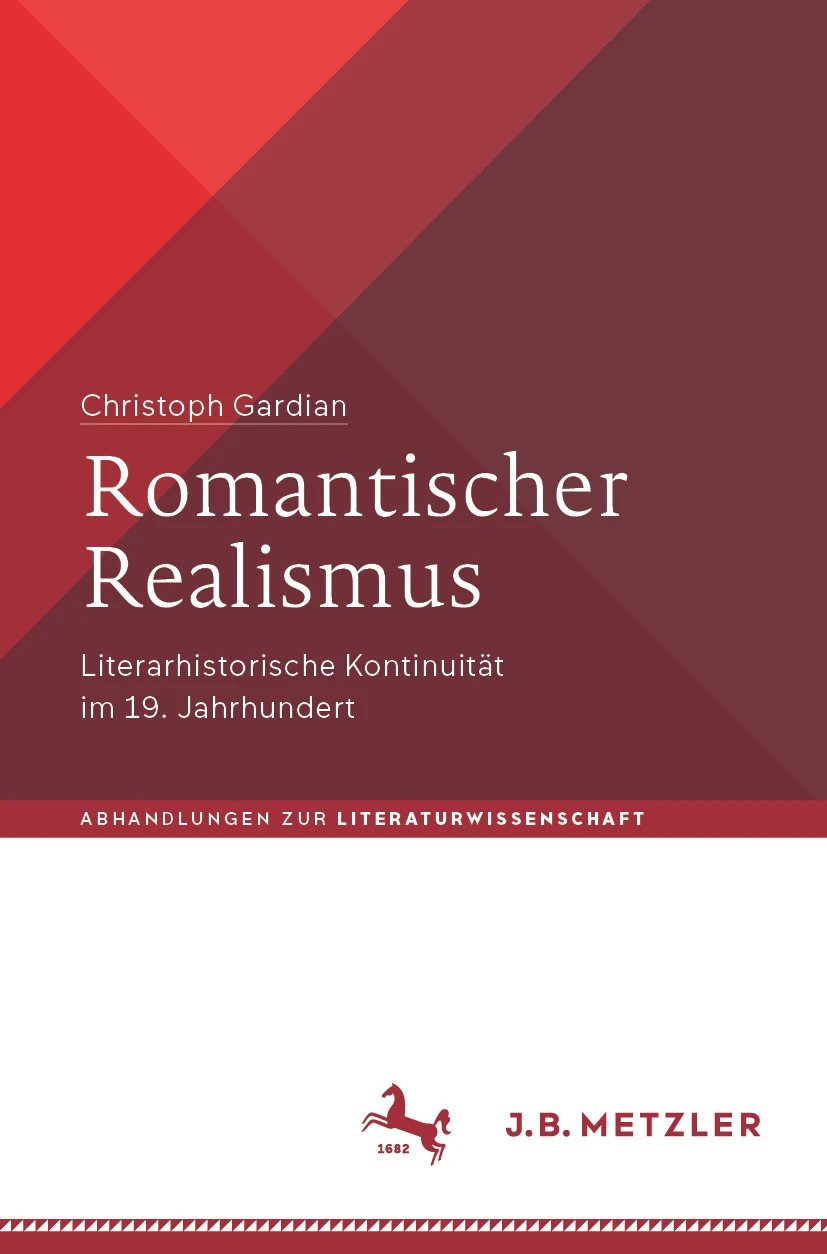Christoph Gardian
Romantischer Realismus
Literarhistorische Kontinuität im 19. Jahrhundert
Bis heute werden Romantik und Realismus oft als unvereinbare Gegensätze angesehen. Ihr Verhältnis wird immer wieder mit Hilfe von Oppositionspaaren wie Entgrenzung vs. Eingrenzung, unendliche Suche vs. Entsagung, Träumen vs. Tatkraft oder auch weiblich vs. männlich beschrieben. Diese vereinfachte Kontrastierung führt zurück ins 19. Jahrhundert, durch dessen Mitte eine klare Grenze zu verlaufen scheint: Politische Ereignisse sowie sozialgeschichtliche und wissenschaftliche Entwicklungen brachten einen Mentalitätswandel hervor, der sich auch literarisch manifestierte. Ab ca. 1850 setzte die Epoche des Realismus ein, die der Romantik mit Kritik begegnete. In der deutschen Literaturgeschichtsschreibung hat sich das Narrativ eines einseitig romantikfeindlichen Realismus verfestigt. Mit seiner Studie deckt Christoph Gardian die Selbstbeschreibung des realistischen Literatursystems auf, macht damit ihren Konstruktionscharakter sichtbar, und arbeitet zahlreiche Formen heraus, in denen die Romantik noch in der Zeit des Realismus fortwirkt.
In einem ausführlichen Einleitungsteil werden der Forschungsstand resümiert, Desiderate offengelegt und Arbeitsthesen formuliert. Leitend ist die problemgeschichtliche Ausgangsüberlegung, dass Realismus wie Romantik auf Probleme der Moderne reagieren, sie „teilen dasselbe Ziel“ (S. 7). So sei bereits in der realistischen Programmatik notwendigerweise ein romantisches Erbe enthalten. Im Vergleich mit England, Frankreich und Russland sei diese relativ starke romantische Tradition in der deutschen Literatur in einer anhaltenden Orientierung am philosophischen Idealismus zu suchen (vgl. S. 29ff.).
Der Schwierigkeit einer Definition des Romantischen umgeht der Verfasser, indem er die untersuchten Texte vornehmlich auf Romantikdiskurse bezieht. Geliefert wird folglich keine Arbeitsdefinition und auch kein heuristisches Modell, mit dem das Phänomen ‚Romantik’ auf beschreibbare Merkmale zugeschnitten werden könnte – solche Ansätze werden von Gardian als „ontologisch“ (S. 13) eingestuft und abgelehnt. Stattdessen widmet sich die Studie jenen Modellen, die in den realistischen Texten als romantisch ausgegeben werden, d.h. dem, was die Realisten selbst unter Romantik verstehen. Das führt zu einem „„weiten Romantikbegriff“ (S. 27), mit dem man sich nicht auf ein womöglich verkürztes Verständnis von Romantik einlassen muss. Dadurch kommt es dann allerdings leicht zu einer kaum systematisierbaren Vielheit von untersuchten Einzelphänomenen.
Die Autorenkapitel sind jeweils durch ein Oberthema strukturiert, das im Einklang mit der bisherigen Forschung steht – so zum Beispiel Religion bei Droste-Hülshoff, Restaurierung bei Stifter oder Ökonomie bei Storm. Das gewährleistet Kohärenz, nimmt aber eine Einschränkung auf spezifische Ausprägungen romantischer Kontinuität in Kauf. Im Zentrum steht die Erzählliteratur, ausgeschlossen ist die Gattung des Dramas sowie, wenngleich mit wenigen Ausnahmen, die Lyrik im Realismus. Die Analyseabschnitte sind hauptsächlich nach Autoren geordnet, die, mit Ausnahme von Otto Ludwig, fest kanonisiert sind. Damit präsentiert die Studie ein für das heutige Realismusbild repräsentatives Korpus, das wissenschaftliche Anschlussfähigkeit gewährleistet. Bewusst ausgeblendet ist die zeitgenössisch vielgelesene, nicht-kanonische Literatur, die in Hinblick auf die Romantik womöglich weitere aufschlussreiche Befunde ergeben hätte.
Anhand von Annette von Droste-Hülshoff untersucht Gardian die romantische Kontinuität im Kontext der Säkularisierung. In diesen Texten wird das Wort Gottes ins Physiologische transformiert, und die Entfremdung vom Göttlichen wird literarisch, unter Rückgriff auf romantische Muster, zu beheben versucht. Im Unterkapitel Romantisches Erzählen ist es das fantastische Erzählen, das die Autorin mit Ludwig Tieck und E.T.A. Hoffmann verbindet. Es ließe sich diskutieren, ob Annette von Droste-Hülshoff und Jeremias Gotthelf, dessen Die Schwarze Spinne vergleichend als Beispiel für eine „‚untergründige’ Fantastik“ (S. 82) hinzugezogen wird, zum Realismus zählen. Im hier gewählten Untersuchungsrahmen sind die Texte allerdings durchaus interessant, da sie eine „Übergangsphase zwischen historischer Romantik und Realismus“ (S. 307) sichtbar machen.
Hinsichtlich des Märchens werden unterschiedliche Konzepte aus der historischen Romantik vorgestellt und an realistische Texte angeschlossen. Anhand von Otto Ludwig lässt sich zeigen, wie künstlerische Reflexivität parodistisch zum Antimärchen umgedeutet wird (vgl. S. 112). Während bei Ludwig eine deutliche Abgrenzung zur Romantik vorliegt und der vermeintlichen Weltflucht ein Sichbescheiden entgegengesetzt wird, zeigt Wilhelm Raabes Die Chronik der Sperlingsgasse in einer höchst aufschlussreichen Analyse einen anderen Umgang mit Romantik: Zwar ist auch diesem Text die Ablehnung einer weltflüchtigen Romantik abzulesen, allerdings ruft er zugleich romantische Merkmale auf, um sie politisch zu funktionalisieren. Das Ziel besteht in der Zukunft der Deutschen Einheit, und das Märchen steht für eine noch kommende Versöhnung. Um diese neue ‚goldene Zeit’ im Sinne einer fortgesetzten politischen Romantik realisieren zu können, müsse die alte, unzeitgemäße Romantik jedoch vollständig überwunden werden.
Adalbert Stifter wird im Kontext der Begriffs- und Motivfelder Restauration/Restaurierung vorgestellt, wobei der Verfasser eine „reduzierte Romantik“ (S. 195) diagnostiziert, die nach Ursprung und Ordnung in einer komplexen Welt sucht. Im ästhetischen Prozess wird dabei, durchaus im Anschluss an die Romantik, Kunst als Konstruktion offenbar, sodass die Widersprüche und grundsätzliche Unmöglichkeit einer vollständigen Wiederherstellungspraxis vorgeführt werden.
Gottfried Kellers Novellen illustrieren, wie der Romantiker als Figur eingeführt wird, die Zeichenhaftes mit Realität verwechselt – was zwar zur Parodie, zugleich aber auch zu einem „romantischen Antikapitalismus“ (S. 205) führt. So stellt sich Romantisches als Möglichkeitsbedingung des Realismus dar, denn die Texte sind „auf einen Rest Romantik angewiesen, um kritikfähig zu bleiben.“ (S. 207) Darüber hinaus erweisen sich romantische Merkmale als Fundament eines Kulturprogramms, dessen Anleitung für die bürgerliche Gesellschaft insbesondere in der Novellengattung zu finden ist. Diese Kulturleistung ist jedoch wiederum nur durch das Verfahren einer Remythisierung zu erreichen, sodass „eine verkehrte Romantik bestritten“ wird, „die dann im Mythos authentischer, ‚natürlicher’ Kultur wieder aufgenommen wird“. (S. 228)
Diese Verdopplung von Romantik in „Vorbild und Antipode“ (S. 222) wird am Beispiel von Theodor Fontane vertieft. Die Romantik-Realismus-Relation wird dabei insbesondere vor dem gesellschaftlichen Hintergrund der preußischen Politik gedeutet; ‚gute’ und ‚schlechte’ Romantik sind mit konkreten Autorennamen bzw. Intertexten verbunden und mit politischen Semantiken korreliert. Während Novalis, Tieck und E. T. A. Hoffmann für die ‚falsche Neuromantik’ stehen, wird die ‚echte Altromantik’ etwa durch Bürgers Ballade Lenore oder auch die Lyrik Hölderlins, die der krankhaften Zerrissenheit der ‚neuen’ Romantik entgegensteht, repräsentiert.
Die Texte Theodor Storms werden im Kontext der Ökonomie gelesen. Dabei bildet sich eine Poetik des Sammelns aus, die in der Anthologie die Möglichkeit einer ‚Naturpoesie’ nach dem ‚Ende der Kunstperiode’ erkennt. Auf diesem Weg wird Romantik als allzu losgelöste Imagination gebannt, zugleich steht sie als Korrektiv gegen eine verengte Weltsicht des Materialismus weiterhin zur Verfügung. Dabei kann sie auch, wie im Fall der Regentrude, für einen Ausgleich von Gegensätzen eingesetzt werden. Spätestens in Carsten Curator ist ein Wandel wahrnehmbar, insofern sich die Wirklichkeit zunehmend der Darstellbarkeit entzieht, womit auch die für den Realismus konstitutive Trennung in ‚gute’ und ‚schlechte’ Romantik brüchig wird. Problemgeschichtlich geht dies einher mit einer Krise wertorientierten Haushaltens der bürgerlichen Gesellschaft. Die zunehmend abstrakten ökonomischen Vorgänge seien Merkmale einer überkomplexen, undurchsichtigen Welt, gegenüber der die Literatur ihr utopisches Potenzial verliert. So handelt es sich beim Schimmelreiter bereits um die Form einer „Wirklichkeit aufhebenden ‚Romantik’“ (S. 303), an der die Beobachtung angeschlossen wird, dass die Epoche des Realismus dort an ihr Ende kommen muss, wo die Differenz zwischen Realismus und Romantik verschwindet. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass Romantik im Realismus insbesondere dort auftritt, wo Selbstbefragungen des eigenen Wirklichkeitsverständnisses vorgenommen werden: „Gerade in Momenten der Selbstvergewisserung […], in den Reflexionen auf ihr Gelingen oder Scheitern bezieht sich die realistische Darstellung auf Romantik oder bringt sie als ihr Anderes erst hervor.“ (S. 306)
Zusammenfassend handelt es sich um eine anregende und äußerst kenntnisreiche Habilitationsschrift, deren Analysen teilweise sehr komplex ausfallen. Ein kleiner Wermutstropfen ist das Inhaltsverzeichnis, das wenig leserfreundlich ist und in den Unterkapiteln kaum Orientierung bietet. So finden sich im Fontane-Kapitel beispielsweise folgende Punkte: Gesellschaftsschichtung, Geselligkeit, Realistische Romantik, Erscheinungen, Fata Morgana, Unkenntlichkeit. Hier wäre es wünschenswert gewesen zu erfahren, welche Texte an welcher Stelle untersucht werden. Etwas schade ist auch, dass in einigen Kapiteln seitenlang keine dezidierte Erwähnung romantischer Phänomene bzw. keine explizite Nennung des Begriffs vorliegt. Während einzelne Unterkapitel wie das bereits oben erwähnte Romantisches Erzählen im Droste-Hülshoff-Teil dankbar sind, weil dort intertextuellen Spuren nachgegangen wird, bleibt der Romantikbezug an anderen Stellen eher implizit. Das führt auch dazu, dass zahlreiche interessante Beobachtungen systematischer Art an verschiedenen Orten verstreut sind und zusammengesucht werden müssen. Noch etwas expliziter hätten schließlich auch die Problemkontexte benannt werden können. Zwar deuten die Kapitel auf spezifische Themen hin, diese werden dann allerdings nicht immer hinsichtlich ihres Problemcharakters ausführlich kontextuell entwickelt.
Offen bleibt zuletzt die Frage, ob sich hinter ‚romantischem Realismus’ der Vorschlag einer Epochenbezeichnung verbirgt. Der Titel deutet das zunächst an, letztlich wird jedoch nicht ausdrücklich dafür argumentiert. Nachdem es sich hier um einen weitgefassten Romantikbegriff handelt, der zudem häufig mit dem ‚Poetischen’ gleichgesetzt wird, drängt sich die Frage auf, worin der Unterschied zwischen ‚romantischem’ und ‚poetischem’ Realismus besteht. Das schmälert die Studie keineswegs, sondern regt zum Weiterdenken an. So liegt insgesamt eine verdienstreiche, die Realismusforschung bereichernde Arbeit vor, die verdeutlicht, dass die Frage nach Romantik-Realismus-Verhältnissen mittlerweile ein eigenes Untersuchungsfeld in der literaturwissenschaftlichen Forschung zum 19. Jahrhundert bildet.
Rezension verfasst von Felix Schallenberg
Die Rezension ist unter dem nachfolgenden Link dauerhaft abrufbar:
https://doi.org/10.22032/dbt.68210