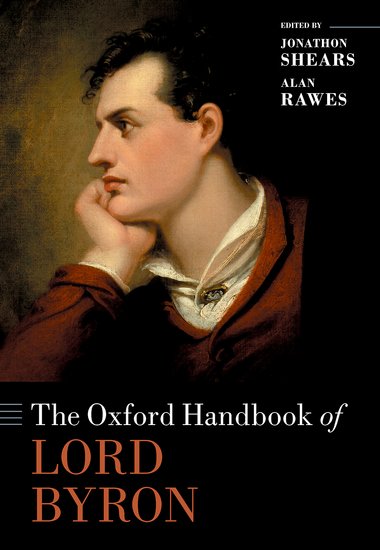Alan Rawes, Jonathan Sears (Hgg.)
The Oxford Handbook of Lord Byron
Am 19. April 1824 starb Lord Byron im Alter von 36 Jahren in Missolonghi, Griechenland, an Fieber und Aderlass. Als sich sein Todestag 2024 zum zweihundertsten Mal jährte, bot dies Anlass zu einem Byron-Revival. Nebst internationalen Tagungen und Ausstellungen - unter anderem in New York, Athen und Melbourne - sowie einem feierlichen Todestags-Dinner im britischen House of Lords erschien eine ganze Reihe bemerkenswerter Bücher zum berüchtigtsten, kommerziell erfolgreichsten und nachhaltig populärsten Vertreter der „big six“ der britischen Romantik. Sowohl Andrew Stauffers Byron: A Life in Ten Letters (Cambridge University Press, 2024) als auch das von Fiona Stafford herausgegebene Byron’s Travels: Poems, Letters, and Journals (Everyman, 2024) erschlossen neue Zugänge zur Biographie des Dichters basierend auf seinen Schriften. Christine Kenyon Jones‘ Jane Austen and Lord Byron: Regency Relations (Bloomsbury Academic, 2024) brachte ihn in Dialog mit seiner wohl berühmtesten literaturschaffenden Zeitgenossin, Sammelbände beleuchteten unter anderem Byrons posthume Bedeutung für das Trinity College, Cambridge (Byron and Trinity: Memorials, Marbles and Ruins, hg. von Adrian Poole, Open Book Publishers, 2024) und seine eigene Tätigkeit als Übersetzer (Byron and Translation, hg. von Maria Schaina und Alexander Grammatikos, Liverpool University Press, 2024). Die aufsehenerregendste Neuerscheinung im „Year of Byron“ ist jedoch das Oxford Handbook of Lord Byron – ein längst überfälliger Beitrag in einer Reihe, in der bereits Handbücher zu den britischen Romantikern Percy Bysshe Shelley, Samuel Taylor Coleridge und William Wordsworth erschienen sind.
Mit 45 Aufsätzen auf fast 800 Seiten ist das Oxford Handbook of Lord Byron mehr als doppelt so umfangreich wie der 2004 erschienene und 2023 neu aufgelegte The Cambridge Companion to Byron (hg. von Drummond Bone, Cambridge University Press). Bis auf zwei Ausnahmen stammen alle Beiträge von Wissenschaftler*innen, die seit Jahrzehnten in der Byron-Forschung tätig sind. Erklärtes Ziel der Herausgeber ist es, das Handbuch für „old and new readers of Byron, […] students and academics alike“ zugänglich zu machen (S. xliv). Kein leichtes Unterfangen bei einem Projekt dieser Größe und Forschungsdichte, und doch ist dies hervorragend gelungen. Nach einer erfrischend kurz gehaltenen Einleitung und einem detaillierten Zeitstrahl, der Byrons Leben historischen Ereignissen gegenüberstellt – dadurch wird nicht zuletzt ersichtlich, wie turbulent, von politischen Umbrüchen und künstlerischen Entwicklungen geprägt seine Lebenszeit war – folgen fünf thematisch geordnete Teile.
„Part I Works“ versammelt Beiträge zu sämtlichen bedeutenden und auch einigen seltener berücksichtigten Werken. Childe Harold’s Pilgrimage sind drei, Don Juan sogar vier Kapitel gewidmet, die freilich oft über den Rahmen dieser einzelnen Werke hinausblicken und es in größere thematische Zusammenhänge stellen. Philip Shaw beispielsweise nimmt den dritten Teil von Childe Harold als Ausgangspunkt, um Darstellungen des Erhabenen in Byrons Texten als Reflexionen dessen eigener Exilerfahrungen zu deuten, und Jane Stabler untersucht Cantos XIII-XVII von Don Juan konkret auf intertextuelle Bezüge zu Dichtern, die Byron in dieser Schaffensphase geprägt haben. Zwingendermaßen fällt die Verteilung disproportional zugunsten der bekanntesten Werke aus – Dramen wie Cain, Manfred, Sardanapalus und Marino Faliero, Dodge of Venice werden jeweils nur auf wenigen Seiten eines Teilkapitels besprochen. Für Childe Harold und Don Juan findet man eine beeindruckende Forschungssynopse, für die übrigen zumindest eine kompakte Übersicht. Darüber hinaus kann der erste Teil des Handbuchs mit einigen durchaus überraschenden Details aufwarten. So erörtert der Beitrag von Shobhana Bhattacharji, „Byron’s Early Poetical Practices“ beispielsweise die ersten, keinesfalls immer gelungenen Schreibversuche des Dichters. Schade nur, dass das allererste überlieferte Gedicht Lord Byrons – ein Spottreim, mit dem er sich an einer Bekannten rächte, die sich über seinen Klumpfuß lustig gemacht hatte (S. 5) zwar beschrieben, aber nirgendwo zitiert wird. Das hätte man als Auftakt gerne im Original gelesen.
Der zweite Teil des Handbuchs ist zugleich der kürzeste. Er trägt den Titel „Biographical Contexts“ und setzt sich in vier Beiträgen mit Byrons Adelsstand, seinem Leben in England und im Exil, seinen zwischenmenschlichen Beziehungen sowie seinem nonkonformistischen, oft geradezu misanthropischen Gebaren auseinander. Während die ersten drei Beiträge vorwiegend auf historischen Quellen – sowohl Zeitzeugenberichte als auch Byrons umfangreiche Briefwechsel – beruhen, vollzieht der letzte, geschrieben von Andrew Stauffer, eine Reihe psychologisierender Interpretationen von Byrons literarischem Werk. Hier wäre ein caveat angebracht gewesen: Byron ist berüchtigt dafür, literarische Figuren zur Selbststilisierung zu nutzen, mit verschiedenen Masken zu spielen und Weltschmerz, Antagonismus und Misanthropie als ästhetische Elemente des Bildes zu verwenden, das er seinen Leser*innen gezielt vermittelt. Stauffer ist sich dessen selbstverständlich bewusst, wie seine kürzlich erschienene Monographie Byron: A Life in Ten Letters zur Genüge zeigt, aber ein*e Leser*in des Oxford Handbook of Lord Byron nicht zwangsläufig. Das Zusammenspiel von Byrons öffentlicher Wahrnehmung und seinen autofiktional anmutenden Texten gehören zu den interessantesten Aspekten seiner Person, aber auch zu den anfälligsten für Fehldeutungen. Sie hätten durchaus einen eigenen Beitrag in diesem Buch verdient oder zumindest dann hervorgehoben werden sollen, wenn Byrons Dichtung zum ersten Mal in einen biographischen Kontext gesetzt wird.
„Part III Literary and Cultural Contexts“ dehnt gewissermaßen das auf Byrons Gesamtwerk aus, was Jane Stabler in „The Textuality and Intertextuality of Don Juan, Cantos XIII-XVII“ bereits anhand eines einzelnen Texts durchspielt. Die Beiträge untersuchen Byrons Verhältnis zu anderen Dichtern – sowohl zeitgenössischen als auch antiken –, zu literarischen Formen wie dem Roman und dem Theater, zu mit ihm assoziierten politischen Bewegungen – insbesondere der von ihm, Percy Shelley und Leigh Hunt gegründeten, kurzlebigen Zeitschrift The Liberal – sowie zur italienischen Literatur. Angesichts der Tatsache, dass Byron gut ein Drittel seines Lebens im Ausland verbrachte, ist gerade letzterer Beitrag, geschrieben von Alan Rawes, aufschlussreich. Man hätte sich vergleichbare Kapitel zur deutschen, französischen oder auch spanischen Literatur vorstellen können – Goethe, Voltaire, Rousseau und Cervantes treten durch das gesamte Handbuch hinweg immer wieder in Erscheinung –, aber wenn ein nationaler Kontext außerhalb des britischen exemplarisch hervorgehoben werden soll, ist der italienische gewiss die richtige Wahl.
Der vierte Teil, „Afterlives,“ ist der wohl aktuellste, was etwas paradox anmuten mag, da erst der abschließende Teil V den Titel „Reading Byron Now“ trägt. Im vierten Teil des Handbuchs finden sich Beiträge wie „Isn’t it Byronic: Reading Byron in the Social Media Age“ von Joanna E. Tylor, „Editing Byron and Digital Futures“ von Paul M. Curtis sowie der bereits erwähnte Artikel von Mark Sandy, der die Kontinuitäten des „byronic hero“ im modernism und der anglophonen Gegenwartsliteratur untersucht. Anlässlich von Byrons 200. Todestag sind diese Kapitel besonders interessant, zeigen sie doch auf, inwiefern der Dichter nicht nur ein nach wie vor ergiebiger Forschungsgegenstand ist, sondern auch in der Populärkultur facettenreich fortlebt: als stilistisches Vorbild, Stoff für Opernadaptionen, als Twitter-Hashtag, als Inspiration für Vampirromane und sogar Fifty Shades of Grey. Hier findet sich zudem Clara Tuites Beitrag „Byron and World Literature“, der viele der Bezüge zu internationalen Zeitgenoss*innen ausarbeitet, die im vorherigen Teil kein eigenes Kapitel bekommen hatten.
„Part V Reading Byron Now“ schließlich bespricht Themen wie Nationalismus, Körperbild, Sexualität und celebrity in Bezug auf Byrons Werk – allesamt interessante und relevante Forschungsperspektiven, die allerdings schon seit den 80er-Jahren weit verbreitet und damit keineswegs so bahnbrechend sind, wie der Titel suggeriert. Die Herausgeber des Oxford Handbook of Lord Byron bedauern in ihrer Einleitung selbst, dass manche „areas of interest [that] are continuously emerging“ wie beispielsweise race und ecocriticism keine eigenen Kapitel gewidmet bekommen und erklären dies damit, dass diese erst gerade begonnen hätten, einen signifikanten Einfluss auf das Feld der Byron Studies zu entfalten (S. xivi). Ein wegweisendes Handbuch wäre eine hervorragende Möglichkeit gewesen, ebensolche Themen voranzutreiben und neben den bereits genannten auch Themen wie Industrialisierung, sexuelle Gewalt oder Drogensucht in den Vordergrund zu rücken. Tatsächlich beinhaltet die 2023 erschienene Neuauflage des Cambridge Companion to Byron Kapitel aus den Bereichen der animal studies und addiction studies. Im Gegensatz dazu findet man hier zu solchen Themen allenfalls Randbemerkungen.
Selbst auf über 700 Seiten ist es ein Ding der Unmöglichkeit, ein derart komplexes und umfangreich erforschtes Thema wie Lord Byron umfassend abzudecken. Das Oxford Handbook of Lord Byron kommt diesem Ziel von allen bisher zu Byron erschienenen Handbüchern am nächsten und lässt sich in der Tat nur für die Aspekte kritisieren, die es nicht enthält. Ausführlichere Auseinandersetzungen mit denjenigen Werken, die nicht im Zentrum des byronischen Kanons stehen, eine Problematisierung biographistischer Interpretationen sowie ein stärkerer Einbezug aktueller literaturwissenschaftlicher Themenfelder hätte den Unterschied zwischen einem hervorragenden Übersichtswerk und einem wegweisenden Forschungsimpuls gemacht. Nichtsdestotrotz sind sämtliche in ihm versammelten Beiträge von höchster wissenschaftlicher und stilistischer Qualität. Sie sind sinnvoll geordnet, einfach zu navigieren, und versammeln die Quintessenz der bisherigen Byron-Forschung zu einem unentbehrlichen Nachschlagewerk. Man kann nur gespannt sein, welche Beiträge die Zweitauflage des Oxford Handbook of Lord Byron eines Tages ergänzen werden.
Rezension verfasst von Andrin Albrecht.
Die Rezension ist unter dem nachfolgenden Link dauerhaft abrufbar: https://doi.org/10.22032/dbt.67217