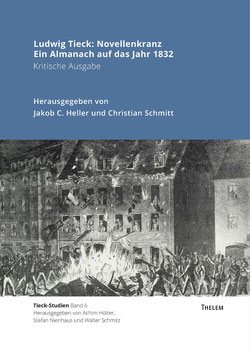Jakob C. Heller, Christian Schmitt (Hgg.)
Ludwig Tieck: Novellenkranz – Ein Almanach auf das Jahr 1832
Kritische Ausgabe
Angesichts der bislang unvollständigen kritischen Werkausgabe von Ludwig Tiecks Œuvre ist es umso erfreulicher, dass Jakob Heller und Christian Schmitt nun eine kritische Edition der beiden wenig beachteten Novellen Der Jahrmarkt und Der Hexen-Sabbath vorgelegt haben. Vor allem die erstgenannte Novelle war bislang nahezu unerforscht. Die Neuausgabe bereichert jedoch nicht nur die Tieck-Forschung. Da Heller und Schmitt die beiden Novellen in ihrem ursprünglichen Rahmen, dem zweiten Band der Taschenbuchanthologie Novellenkranz (1831), edieren, vermitteln sie einen innovativen Eindruck vom Publikations- und Rezeptionskontext innerhalb des in den 1830er Jahren florierenden Taschenbuchformats. Der Aufstieg des Taschenbuchs markiert in Tiecks Werk zugleich eine entscheidende Zäsur: die verstärkte Hinwendung zur Novelle. Die Edition macht diese medienhistorisch spannende Konstellation sichtbar und führt die beiden Novellen, die bislang meist getrennt voneinander in Einzel- und Werkausgaben erschienen sind, wieder zusammen. Damit liefern die Herausgeber wertvolle Impulse für die Interpretation. Heller und Schmitt zeigen eindrucksvoll, wie ertragreich eine medienhistorische Perspektive für die Lektüre, Interpretation und nicht zuletzt Edition von Tiecks Werken sein kann.
Zu Beginn der Novellenanthologie steht eine Reproduktion von sieben Stahlstichen, die die Leser:innen mit Illustrationen zu Tiecks Drama Leben und Tod der heiligen Genoveva (1802) – dem wohl bekanntesten Werk Tiecks zu seinen Lebzeiten – auf die Lektüre des Novellenkranzes einstimmen. Den einzelnen Abbildungen sind passende Zitate aus der Genoveva zugeordnet. Wie die Herausgeber im Kommentarteil überzeugend darlegen, erinnern die reizvollen Illustrationen des nazarenisch geprägten Künstlers Wilhelm Hensel nicht nur an Tiecks berühmtes Drama, sondern lenken auch gezielt die Rezeption der Leser:innen: Die Illustrationen stellen eine Kontinuität zwischen Tiecks romantischer Frühphase und seiner späteren novellistischen Werkphase her. Die einleitenden Bilder sind so als Beitrag zur erinnerten Romantik des späten Tieck deutbar. Inhaltlich knüpfen auch die beiden Novellen an Tiecks Bearbeitung der christlichen Genoveva-Legende an, indem sie sich mit Themen wie Schwärmerei, Religiosität und Massenwahn auseinandersetzen. Für Der Jahrmarkt und Der Hexen-Sabbath wählt Tieck jedoch unterschiedliche ästhetische Modi: Während im Jahrmarkt auf komische Weise eine provinzielle und philiströse Reisegesellschaft zur neurotischen Projektionsfläche einer von einer kriminellen Bande terrorisierten Stadtgesellschaft wird, behandelt der Hexen-Sabbath nach dem Vorbild von Walter Scotts historischen Romanen den Hexenwahn des 15. Jahrhunderts in Flandern – mit fatalem Ausgang für die Protagonisten. Die beiden Novellen bilden so die zwei Gesichter eines janusköpfigen Werkes.
Auf die edierten Novellen folgt ein Verzeichnis, in dem die Herausgeber ihre wenigen Emendationen des Texts, wie z. B. offensichtliche Druckfehler, dokumentieren. Der anschließende Stellenkommentar ist äußerst hilfreich, besonders im Hinblick auf die zahlreichen intertextuellen und intermedialen Anspielungen im Jahrmarkt. Auch die vielfältigen theologischen und kirchengeschichtlichen Bezüge des Hexen-Sabbath werden durch die Erläuterungen leichter zugänglich. An einzelnen Stellen hätte der Kommentar jedoch etwas zurückhaltender und weniger interpretierend ausfallen dürfen. Besonders die Hinweise auf mögliche Romantik-Bezüge im Hexen-Sabbath überschreiten mitunter den Rahmen einer editorischen Erläuterung.
Drei Essays ergänzen die Edition und führen in den Kontext des Novellenkranzes ein. Im ersten Essay erläutern die Herausgeber die Entstehungs- und Wirkungsgeschichte des Taschenbuchformats. Zwei weitere Essays widmen sich der detaillierten Interpretation der beiden Novellen. Schmitt legt den Schwerpunkt auf die medienhistorische Dimension des Jahrmarkts. Er zeigt, dass Tieck darin einen kritischen Blick auf das Manipulationspotenzial der im Vormärz aufkommenden Massenmedien wirft. Damit lässt sich die komische Novelle als Kommentar zur Julirevolution von 1830 lesen – eine Deutung, die durch das Buchcover, das eine Darstellung der Unruhen in Dresden im Jahr 1830 zeigt, von den Herausgebern vielleicht etwas zu stark forciert wird. In eine ähnliche Richtung weist Hellers Einführung zum Hexen-Sabbath, die die Novelle als „Modell gesellschaftlicher Prozesse und Strukturen“ (S. 546) deutet, das „der Tieck’schen Gegenwart als Spiegel vorgehalten wird“ (ebd.). Heller stützt sich dabei auf Patrick Eiden-Offes Poesie einer Klasse und hebt insbesondere die Rolle des „Pöbels“ (S. 548) bei der Hexenverfolgung hervor. Aus dieser überzeugenden Perspektive erscheinen sowohl der Hexen-Sabbath als auch der Jahrmarkt als Analysen der kulturmedialen Bedingungen der Julirevolution.
Die einführenden Essays tragen wesentlich zum Verständnis der Novellen bei, wenngleich Schmitts ausführliche mediengeschichtliche Kontextualisierung des Jahrmarkts stellenweise eine Eigendynamik entwickelt, die über eine bloße Einführung hinausgeht. Fraglich bleibt auch, inwieweit die zusätzlichen mediengeschichtlichen Illustrationen und Materialien im Anhang der Edition einen echten Mehrwert für das Verständnis der Novellen bieten. Besonders irritierend ist, dass das Coverbild des Buches im Anhang erneut abgedruckt wird und dass die farbigen Drucke dort eine höhere Qualität aufzuweisen scheinen als die Schwarz-Weiß-Reproduktionen der Stahlstiche. Zusammen mit dem umfangreichen Stellenkommentar sowie der großzügigen Gestaltung des Textteils (große Schrift, weiter Zeilenabstand, breite Ränder) trägt der Bilderanhang dazu bei, dass die Edition ein voluminöses – und entsprechend kostspieliges – Buch geworden ist. Die kritische Ausgabe des Novellenkranzes wird daher vermutlich, wie viele vergleichbare Editionen, vor allem in akademischen Bibliotheken rezipiert werden. Dies gilt umso mehr, als die Ausgabe bislang nicht digital zugänglich ist. Gerade im Fall der Edition eines Taschenbuchs sind diese Rezeptionshemmnisse besonders bedauerlich, da sich hier die Herausgeber trotz ihrer innovativen medienhistorischen Sensibilität deutlich vom Taschenbuchformat des Originals entfernt haben. Dessen ungeachtet stellt Schmitts und Hellers Edition des Novellenkranzes – abgesehen von kleineren formalen Fehlern im kritischen Apparat, die den Lesefluss nicht beeinträchtigen – eine vollkommen gelungene wissenschaftliche Neuausgabe dar. Ihre Orientierung an den ursprünglichen Rezeptionskontext hält der künftigen Tieck- und Romantikedition ein Muster bereit.
Rezension verfasst von Sigmund Jakob-Michael Stephan.
Die Rezension ist unter dem nachfolgenden Link dauerhaft abrufbar: https://doi.org/10.22032/dbt.66982